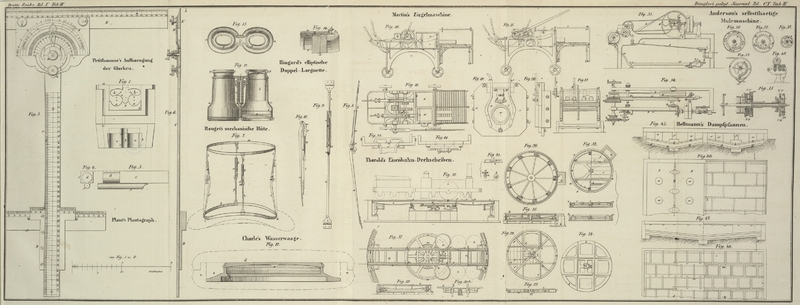| Titel: | Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf sich William Anderson, Baumwollspinner zu Clitheroe in Lancasshire, am 22. Oct. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 110, Jahrgang 1848, Nr. XXX., S. 164 |
| Download: | XML |
XXX.
Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen, worauf
sich William Anderson,
Baumwollspinner zu Clitheroe in Lancasshire, am 22. Oct. 1846 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, August 1848, S.
7.
Mit Abbildungen auf Tab.
III
Anderson's Verbesserungen an Baumwollspinnmaschinen.
Vorliegende Erfindung bezieht sich
1) auf ein eigenthümliches Verfahren, die Streckwalzen zu belasten;
2) auf Verbesserungen an den sogenannten selbstthätigen Mulespinnmaschinen und
insbesondere auf die unter dem Namen „Smith's
self-actor“ bekannte Mulemaschine (beschrieben im
polytechn. Journal Bd. LV S. 229). Dieser Theil der Erfindung besteht in einer gewissen
neuen Anordnung des Apparates, wodurch das Loswickeln „backing of“ der spiralförmigen Windungen,
welche nach jedem Auszug des Wagens auf den Spitzen der Spindeln bleiben,
bewerkstelligt wird, ferner in einer neuen Methode, die Umdrehung der Achse der
Twistrollen zu hemmen.
Fig. 33 stellt
einen Theil der Mulemaschine mit den an derselben angebrachten Verbesserungen im
Seitenaufrisse, Fig. 34 im Grundrisse dar. A, A ist die
Treibrolle, welche an die Welle B festgekeilt ist und
die Bewegung der Querwelle C vermittelst der Winkelräder
D, D mittheilt. An dieser Querwelle befindet sich
eine Rolle E, welche mittelst eines Riemens die Welle
F in Umdrehung setzt, und noch eine andere Rolle G, welche während der Operation des Spinnens mit Hülfe
des Riemens I die Rollenachse H in Bewegung setzt. Die Einrichtung der Achse H läßt sich am besten aus dem Längendurchschnitt Fig. 35 und aus den
Querschnitten Fig.
36, 37, 38 und 39 entnehmen. Fig. 36 ist ein
Durchschnitt nach der Linie A B
Fig. 35; Fig. 37 nach
der Linie C D; Fig. 38 nach der Linie
E F; Fig. 39 nach der Linie
G H. a ist die
Treibrolle; b, b sind die Twistrollen, welche die zum
Treiben der Spindeln dienlichen Trommeln in Bewegung setzen. In dem Innern der
festen Rolle a befindet sich ein Sperrrad c, welches lose an der Achse H sitzt, jedoch durch die Sperrkegel d, d, d
mit der Rolle a verbunden ist, und während des Spinnens
mit ihr rotirt. Dieses Sperrrad ist innen mit einem Zahnkranz e, e versehen, in den das kleine Getriebe f
greift. Letzteres befindet sich an einem Bolzen, welcher durch die gleichfalls lose
an der Welle H sitzende Platte g geht. An dem nämlichen Bolzen, jedoch auf der andern Seite der Scheibe
g, ist ein kleines Sperrrad h befestigt, und ein an das Zahnrad k
befestigter Sperrkegel i wird durch eine Spiralfeder I (Fig. 37) außer
unmittelbarer Berührung mit dem Sperrrädchen h gehalten.
Das Zahnrad k sitzt lose an der Welle H und rotirt in dem Innern der gewöhnlichen
Frictionsrolle m, um welche die Bänder zur Ertheilung
der für das Aufwinden erforderlichen Friction laufen. Die Rolle m dreht sich lose auf der Röhre n, die gleichfalls lose an der Achse H sitzt.
An die Röhre n ist die Scheibe o befestigt, welche das Getriebe p enthält. An
dem andern Ende der Röhre n ist ein Sperrrad q befestigt, welches durch Sperrkegel r, r, r mit dem Getriebe s
verbunden ist; letzteres steht mit einem Rade in Eingriff, welches an der Seite des
gewöhnlichen hin- und her oscillirenden Rades (mangle-wheel) befestigt ist. t ist die
Rolle zum Rückwärtsdrehen der Spindeln (the
backing-off pulley), welche lose an der Welle H steckt, jedoch während des Rückwärtsdrehens durch das Frictionsband u, u mit derselben verbunden wird, indem man das
letztere gegen die an der Büchse der Garnrolle b
festsitzende Rolle v drückt. Es erhellt somit, daß
während der Wagen ausgezogen wird und die Operation des Spinnens vor sich geht, die
in Rotation gesetzte Garnrollenachse H die Garnrollen
b, b und die Frictionsrolle v mit sich nimmt. Der Treibriemen wird sodann auf die lose Rolle geschoben
und die Welle H durch nachher zu beschreibende Mittel
rückgängig gemacht. Sobald aber das Aufwinden des Garns beginnt, kommt das Zahnrad
k im Innern der Frictionsrolle m in Rotation, und da der Sperrhaken i in das Sperrrad k
einfällt, so wird dadurch die Rotation des Getriebes f
verhütet; die Scheibe g und das Rad c kommen in Umdrehung, und vermittelst der Sperrhaken d, d, d wird sofort der ganze Apparat mit der Achse H in Eingriff gebracht. Der Apparat, um die an der
Garnrollenachse befindliche feste Rolle a zu bremsen und
diese Achse rückgängig zu machen, ist Fig. 33 und 34
dargestellt. An dem einen Ende des belasteten Hebels w
ist die Bremse x befestigt und an dem andern Ende
desselben befindet sich ein Stift y, welcher auf einem
Haken z ruht. Wenn der Wagen seinen Auszug beinahe
vollendet hat, so zieht eine Hervorragung des Wagens den Haken z zurück. Diese Bewegung gestattet dem Hebel w zu fallen, die Bremse mit der Rolle a in Berührung zu bringen und auf diese Weise die
Rotation der Achse H zu hemmen. Ein anderer Theil des
Wagens kommt gegen den Hebel I und drückt ihn nieder,
wodurch der belastete Hebel w wieder in seine
ursprüngliche Lage gehoben und die Bremsvorrichtung zurückgezogen wird. Ein anderer
Theil des Wagens schlägt nun gegen den Finger 2, wodurch der Haken 3 von dem Stift 4
abgehoben und der belastete Hebel 5 veranlaßt wird zu fallen und mit Hülfe der
Stange 6 die Kuppelung 7,8 in Eingriff zu bringen. Die eine Hälfte 7 der Kuppelung
sitzt an der Büchse des Zahnrades 9 fest, welches durch das an der Querwelle F befindliche Getriebe 10 umgetrieben wird. Die andere
Hälfte 8 der Kuppelung sitzt an der Rolle 11, an welche das eine Ende der Kette 12
befestigt ist. Das andere Ende der Kette 12 ist an den Hebel 13 und dieser ist an
das Frictionsband u befestigt. Sobald nun die Theile 7
und 8 der Kuppelung in Eingriff gebracht sind, drücken sie das Frictionsband u gegen die Rolle v, ziehen
dadurch die Garnrollenachse um eine Rotation zurück und lösen die Garnspiralen von
den Spitzen der Spindeln ab. Ein anderer Theil des Wagens stößt alsdann gegen den
Hebel 14 und hebt den belasteten Hebel 5 in seine ursprüngliche Lage zurück. Dadurch
kommen die Theile 7, 8 der Kuppelung außer Eingriff, worauf der Wagen zurückgeht und
das Garn aufwickelt.
Die verbesserte Methode, die Streckwalzen zu belasten, ist Fig. 40 dargestellt; a, a, a sind die oberen, b, b,
b die unteren Walzen. Das erste Paar der Streckwalzen ist auf die übliche
Weise beschwert, das zweite und dritte Paar aber wird vermittelst der auf beiden
liegenden Walze c belastet. Durch diese Methode wird das
Anknüpfen erleichtert und Zeit und Arbeit gespart.
Tafeln