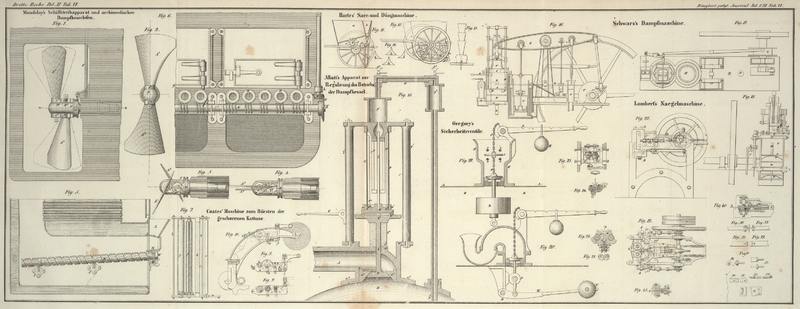| Titel: | Maudslay's patentirter selbstthätiger Schiffstreibapparat und archimedischer Dampfkesselofen. |
| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. LXIV., S. 321 |
| Download: | XML |
LXIV.
Maudslay's patentirter selbstthätiger Schiffstreibapparat und
archimedischer Dampfkesselofen.
Aus dem Mechanics' Magazine, 1848, Nr.
1313.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Maudslay's selbstthätiger Schiffstreibapparat.
Der neue Dampftreibapparat, welcher den Hauptgegenstand des vorliegenden Patentes
bildet, beseitigt eines der größten Hindernisse, die seither der Dampfschifffahrt im
Wege gestanden, nämlich die Schwierigkeit den Treibapparat, er möge nun aus
schraubenförmigen Flügeln oder aus flachen Schaufeln bestehen, mit der Treibwelle in
und außer Verbindung zu bringen. Hr. Maudslay befestigt nämlich die Treibflügel dergestalt an die Welle,
daß der Apparat, sobald die Welle in Rotation gesetzt wird, von selbst in den zur
Forttreibung geeigneten Winkel sich stellt, und augenblicklich in eine neutrale oder
unwirksame Lage zurückkehrt, sobald die Welle zu rotiren aufhört.
Fig. 1 stellt
einen Theil des Sterns von einem mit dem verbesserten Treibapparat ausgerüsteten
Schiffe dar. Fig.
2 ist eine abgesonderte Ansicht des Instrumentes und Fig. 3 ein
Längendurchschnitt des Instrumentes und seiner Verbindungen nach der Linie ab in Fig. 1. Die Treibflügel
A¹ A² sind
mit ihren inneren oder schmalen Enden in Hülsen B¹ B² an dem Ende der Treibwelle S eingefügt, in denen sie sich bis zu einer gewissen
Ausdehnung drehen können. An den Stiel jedes Treibflügels sind zwei gezahnte
Segmente C¹ C¹, C² C² befestigt, an dem obern Theile jeder Hülse das eine und an dem
unteren Theile derselben das andere. Beide Segmente stehen mit einander in Eingriff
innerhalb der durch die Aufhälter f, f bestimmten
Gränzen, so daß die Treibflügel stets gemeinschaftlich und symmetrisch sich bewegen.
E ist eine verschiebbare Kuppelung, welche gegen den
Stern hin bewegt werden kann, so daß sie einen der Stifte d,
d und e, e, die von dem hintern Rade des
innersten Treibflügels A² hervorragen, ergreifen. F ist eine verticale Stange, mit deren Hülfe die
Kuppelung E vom Deck des Schiffes aus bewegt werden
kann; diese Stange endigt sich unten in eine Schraube, welche in eine bewegliche Nuß
n greift, die an dem einen Arm eines Winkelhebels
G angebracht ist; der andere Hebelarm umfaßt mit
seinem gabelförmigen Ende die Kuppelung E. Die
Wirkungsweise dieses Treibapparates ist nun folgende. Angenommen, die Kuppelung sey
ausgelöst, und die Treibwelle werde in Rotation gesetzt, so bewegen sich
augenblicklich die Flügel in die zum Forttreiben geeigneten Winkelstellungen, und
verharren in diesen so lange als die Rotation der Treibwelle dauert. Sollte die
Veranlassung entstehen rückwärts zu steuern, so befestigt man die ausgebreiteten
Flügel, indem man die Kuppelung mit den Hervorragungen d,
d an der hintern Seite der gezahnten Segmente des inneren Flügels A² in Eingriff bringt. Wenn die Maschine in
Stillstand gesetzt und die Kuppelung zurückgezogen wird, so drehen sich die
Treibflügel in Folge der Einwirkung des Wassers auf dieselben in ihren Hülsen, bis
sie mit dem Lauf des Schiffes in eine Linie kommen und nur ihre scharfen Kanten, wie
Fig. 4
zeigt, dem Wasser darbieten; der größeren Sicherheit wegen werden sie dann in dieser
Lage befestigt, indem man die Kuppelung E mit den
Hervorragungen e, e an der Rückseite der erwähnten
Segmente in Eingriff bringt.
Die Eigenthümlichkeit des neuen Kesselofens besteht in der Anwendung rotirender
schraubenförmiger Roststäbe. Fig. 5 stellt diesen Ofen
im Längendurchschnitte, Fig. 6 in der Frontansicht
dar. H, H sind die Roststäbe, welche nicht wie
gewöhnlich fest sind, sondern aus einer Reihe von Röhren bestehen, die in Lagern
rotiren, an beiden Enden offen, an der äußeren Seite mit Schraubengängen versehen
und mit zahlreichen Luftlöchern durchbohrt sind. An dem vorderen Ende jeder Röhre
befindet sich eine breite Schulter f, welche zum Ofen
herausragt, und mit einem Schraubenrad W versehen ist.
Quer über die Vorderseite des Ofens erstreckt sich eine mit endlosen Schrauben
besetzte Welle K, welche vermittelst der Winkelräder N, O von der Dampfmaschine aus in Rotation gesetzt wird.
Diese endlose Schraubenwelle greift in die ganze Reihe Schraubenräder W und theilt somit den erwähnten Roststäben eine
beständige Rotation mit. L ist ein mit einem
Drosselventil (Klappe) versehener Behälter, durch den der Ofen mit Kohlen beschickt
wird. Aus diesem Behälter fallen die Kohlen auf eine geneigte Rinne M, welche sie auf das vordere Ende der Roststäbe fallen
läßt. Von da bewegen sich die Kohlen in Folge der Rotation der Roststäbe und der Wirkung ihrer
schraubenförmigen Oberflächen allmählich von vorn nach hinten. Asche oder Schlacken
können sich auf den Roststäben wegen ihrer fortwährenden Rotation nicht
anhäufen.
Tafeln