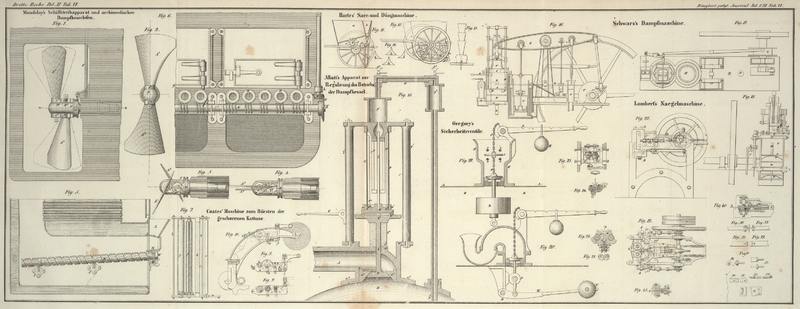| Titel: | Verbesserungen an Nägelmaschinen, worauf sich Charles Lambert, Stiftfabricant zu Saint Georges bei Bristol, am 5 Jan. 1848 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 111, Jahrgang 1849, Nr. LXVIII., S. 329 |
| Download: | XML |
LXVIII.
Verbesserungen an Nägelmaschinen, worauf sich
Charles Lambert,
Stiftfabricant zu Saint Georges bei Bristol, am 5 Jan. 1848 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of arts, Nov. 1848, S.
229.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Lambert's Verbesserungen an Nägelmaschinen.
Den Gegenstand dieser Erfindung bilden gewisse neue Theile einer Maschine, worin
glühende Eisenstangen vermittelst excentrischer Walzen oder rotirender Excentrica
zunächst in Keile oder in Reihen zusammenhängender Keile verwandelt werden, die dann
zu Nägeln auseinanderzuschneiden sind. Diese neuen Maschinentheile sind: 1) ein paar
bewegliche Führungen, um das Ende der heißen Eisenstange vorwärts zu führen, nachdem
letztere durch die geeigneten Walzen in eine Reihe keilförmiger zusammenhängender
Theile gepreßt worden ist; 2) schneidende und festhaltende Formen, deren Ränder dazu
dienen, einen Theil des Nagelschaftes horizontal abzuschneiden, um ihm an der oberen
Seite eine geneigte oder keilförmige Gestalt zu ertheilen, welche der seitlichen
Gestalt des durch die excentrischen Walzen hervorgebrachten Nagels entspricht; 3)
ein eigenthümlich construirtes Doppelmesser, um die erwähnten keilförmigen Theile
der Eisenstange von einander zu trennen.
Fig. 21 zeigt
eine Nägelmaschine, bei der die neuen Theile mit dem alten bekannten Mechanismus
verbunden sind, im Grundrisse und Fig. 22 im
Seitenaufrisse. Fig. 23 ist ein theilweiser Verticaldurchschnitt nach der Linie AB in Fig. 21 und 22. Letztere
Figur erläutert die excentrischen Walzen a, a, durch
welche die quadratischen Eisenstangen b, b in die Reihe
zusammenhängender Keile verwandelt werden. Fig. 24 stellt diese
Walzen im horizontalen Durchschnitte dar. Fig. 25 zeigt die neuen
Haupttheile der Maschine abgesondert im horizontalen Durchschnitte. Die zwischen den
Walzen a, a gebildeten Keile gelangen zwischen ein Paar
beweglicher Führungen c, c, während sich die schrägen
Schneiden mittelst Hebelwirkung einwärts bewegen, um einen Theil der oberen Seite
des nächstvorhergehenden Nagels horizontal in geneigter Richtung abzuschneiden.
Dieses wird aus dem senkrecht durch die Mitte der Maschine geführten theilweisen
Längendurchschnitte Fig. 40 erhellen.
Fig. 26
stellt die beweglichen Führungen c, c und ihre
Verbindung mit den Walzen a, a nach einem größern
Maaßstabe im horizontalen Durchschnitte dar. Das zwischen den Preßwalzen
hervorkommende Ende der Eisenstange b tritt in einen
röhrenförmigen Canal f
Fig. 21, in
dessen Innerem die beweglichen Führungen c, c wirksam
sind. Diese Führungen bestehen aus zwei horizontalen auf einer Platte gelagerten
Hebeln, welche sich um die Zapfen g, g
Fig. 26
drehen und durch eine Fig. 27 in der
Seitenansicht sichtbare Feder h, h offen erhalten
werden. Die schnabelförmigen Enden i, i der beweglichen
Führungen werden durch die Feder h gegen die Peripherien
der excentrischen Walzen a, a angedrückt. Indem nun die
letzteren rotiren, drücken die zunehmenden gegen die Schnäbel wirkenden Halbmesser
die Hebel oder Führungen zusammen. Wenn dagegen die abnehmenden Halbmesser der
excentrischen Walzen mit den Schnäbeln in Berührung kommen, so gehen die Führungen
auseinander, und der zwischen ihnen befindliche Canal ist für den freien Durchgang
der Stange offen.
Die rotirende Bewegung der Walzen a, a wird in
Intervallen durch ein Sperrrad nebst Sperrkegel bewerkstelligt. Somit wird bei jeder
Bewegung der Walzen durch den Druck gegen die Seiten der glühenden Eisenstange ein
Keil gebildet; dagegen werden bei jeder zeitweisen Einstellung der Rotation die
andern Maschinentheile durch die mit der Hauptwelle verbundenen excentrischen
Scheiben und Hebel in Thätigkeit gesetzt. Angenommen, die Rotation der excentrischen
Walzen sey für einen Augenblick eingestellt, und die beweglichen Führungen c, c haben einen der keilförmigen Theile der Stange
zwischen sich, so bewegen sich die schneidenden Theile, d,
e seitwärts, um einen Theil des nächsten Keils an der obern Seite in
geneigter Richtung abzuschneiden. Die Construction dieser schrägen Schneiden, welche
den zweiten Haupttheil der in Rede stehenden Erfindung bilden, wird aus den Figuren
28–33 erhellen. Fig. 28 stellt den
Grundriß der einen, Fig. 29 den der andern Schneide dar; Fig. 30 ist die vordere
Ansicht, Fig.
31, die Endansicht von Fig. 28; Fig. 32 ist die vordere
Ansicht und Fig.
33 die Endansicht von Fig. 39.
Die Messer d, e, durch die der Nagel seine gegen die
Spitze hin verjüngte Form erhält, werden vermittelst excentrischer, an der
Hauptwelle befindlicher Scheiben in Bewegung gesetzt, indem diese die Enden der
Hebel k, k auseinandertreiben, wodurch die
entgegengesetzten Hebelenden mit den Messern d, e
zusammengehen, und wie Scheren gegen den obern Rand des Nagels wirkend, einen Theil
des Nagelschaftes abschnitzen. Nachdem die oberen Theile der Messer d, e
ihre Wirkung vollbracht haben, drücken die unteren Theile derselben gegen die Seiten
des Nagelschaftes und halten ihn fest, während die Operation der Kopfbildung vor
sich geht. Die Kopfformen mögen wie Fig. 34 und 35 beschaffen
seyn oder irgend eine andere Gestalt haben, und auf die Fig. 21 und 22
dargestellte Weise oder durch einen sonstigen geeigneten Mechanismus in Wirksamkeit
gesetzt werden.
Während nun auf solche Weise der Nägelschaft zwischen den Theilen d, d festgehalten wird, kommt der dritte Haupttheil,
nämlich die Doppelmesser l und m in Wirksamkeit, durch welche die Nägel der Reihe nach von dem Ende der
Stange abgeschnitten werden. Diese in Fig. 36, 37, 38 und 39 nach einem größern
Maaßstab dargestellten Messer sind an verschiebbaren Querstangen n, n befestigt, welche mittelst doppelt geneigter Ebenen
p, p bewegt werden. Letztere sind an den vermittelst
der excentrischen Scheiben r, r von der Treibwelle aus
bewegten Seitenstangen q, q befestigt, und wirken in
Schlitzen, die an den Stangen n, n angebracht sind. Die
Messer l und m kommen in
Folge der Maschinenbewegung einander näher, während derjenige dünne Theil der
Stange, welcher die Spitze des einen Nagels mit dem Kopf des nächstfolgenden
verbindet, sich gerade zwischen den Schneiden befindet, wie aus Fig. 36 und 37 ersichtlich
ist. Die doppelten Schneiden haben den Zweck, daß nicht allein das Ende des vorderen
Nagels mit einer scharfen meißelförmigen Spitze glatt abgeschnitten wird, sondern
auch ein kleiner Theil des winkeligen Endes des folgenden Nagelschaftes, um diesen
für die Operation des Kopfbildens besser vorzubereiten; denn wenn an diesem noch ein
kleines Stückchen übrig bliebe, so würde das letztere nach einer Seite getrieben und
somit ein ungleichförmiger Kopf entstehen. Das kleine zwischen je zwei Nagelschäften
ausgeschnittene Eisenstückchen fällt durch eine in dem Messer m angebrachte Höhlung heraus.
Tafeln