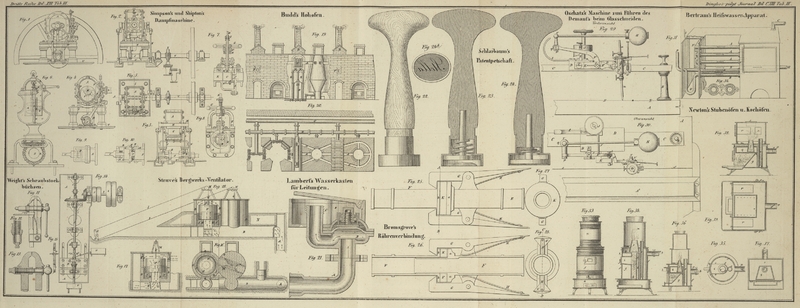| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich die Civilingenieure Joseph Simpson und James Shipton in Manchester, am 14. August 1848 ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 113, Jahrgang 1849, Nr. XL., S. 161 |
| Download: | XML |
XL.
Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich die
Civilingenieure Joseph
Simpson und James
Shipton in Manchester, am 14. August
1848 ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1849,
S. 287.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Simpson's Verbesserungen an Dampfmaschinen.
Fig. 1 stellt
eine stationäre Dampfmaschine im Seitenaufrisse,
Fig. 2 in der
Endansicht,
Fig. 3 in der
Endansicht und zwar im Durchschnitte nach der Linie AA
Fig. 5,
Fig. 4 im
Seitendurchschnitte nach der Linie BB
Fig. 5,
und
Fig. 5 im
Grundrisse dar. Gleiche Buchstaben dienen in sämmtlichen Figuren zur Bezeichnung
gleicher Theile.
A, Fig. 1, stellt die
Dampfkammer dar, welche die Stelle des Cylinders bei gewöhnlichen Dampfmaschinen
vertritt und daher in der folgenden Beschreibung Cylinder genannt werden soll. B ist die Ventilbüchse, worin ein Schiebventil E, Fig. 4, angeordnet ist,
das durch die Seitenstangen C und das Querstück D in Thätigkeit gesetzt wird. Die Eigenthümlichkeiten
dieses Schiebventils sollen weiter unten beschrieben werden. Der Dampf tritt durch
die Canäle F, F, Fig. 4, in den
Cylinder.
Im Cylinder A ist eine metallene Trommel oder ein Kolben
G angeordnet, welcher mit einer Achse H versehen ist. Diese Achse geht nicht durch die Mitte,
sondern so durch den Kolben, daß eine excentrische Bewegung erzeugt wird; sie liegt
ferner nicht in festen sondern in beweglichen Lagern, welche einen Theil der
Seitenstangen I, I bilden. Letztere gehen von der
Kurbelwelle J aus, auf der sie gelagert sind. In den Seiten des
Cylinders A befindet sich eine Oeffnung L; durch diese Oeffnung und durch das Excentricum G tritt die Achse H. Die
Oeffnung L ist länglich, so daß die Achse H sich vor- und zurückbewegen kann; denn dieses
muß der Fall seyn, wenn der Kolben G in Folge seiner
Excentricität von dem einen Ende des Cylinders zum andern getrieben wird. Vermöge
der Seitenstangen I, I wird die Achse H stets in vollkommen gleichem Abstande von der
Kurbelwelle J erhalten. Die Achse H setzt die Welle J vermittelst der Kurbeln
M, M, der Verbindungsstangen N, N und der Kurbeln O, O in Rotation.
Der excentrische Kolben mag sich in was immer für einer Lage befinden, die
Seitenstangen I, I und die Verbindungsstangen N, N stehen vollkommen parallel zu einander, wodurch die
directe Wirkung der Kraft auf die Kurbelwelle J
gesichert wird, und alle jene zwischen einer gewöhnlichen Lenkstange und einem
Kolben stattfindenden Winkel vermieden werden. Der Kolben G wird durch eine bewegliche Platte P, gegen
die er sich reibt, dampfdicht erhalten. Diese Platte paßt dampfdicht in eine
seitwärts am Cylinder angebrachte Vertiefung und wird durch Federn gegen die
cylindrische Seite des Kolbens angedrückt, so daß sie nach Maaßgabe der Abnützung
des Kolbens nachfolgen und stets dampfdicht schließen kann; wir beabsichtigen, gegen
die Rückseite dieser beweglichen Platte mittelst einer dünnen Röhre Dampf zu leiten.
An den Enden des Kolbens wird ein dampfdichter Schluß vermittelst concentrischer
Ringe bewirkt. Diese Ringe sind an einer Seite durchgeschnitten und ein Metallkeil
durch eine Stahlfeder in jede Oeffnung gedrückt; auf diese Weise wird ein
dampfdichter Schluß zwischen dem Kolben und den flachen Seiten des Cylinders
bewerkstelligt.
Das Schiebventil E wird durch ein gewöhnliches
Excentricum R in Bewegung gesetzt. Eine Achse S theilt die Bewegung von dem Excentricum den
Seitenstangen C und dem Ventil E mit. T ist das Maschinengestell; U die Bodenplatte; V die
Schwungradwelle; W die Speisungspumpe; X ein gewöhnliches Excentricum zum Betrieb der
letzteren; Y die Dampfröhre; Z die Luftpumpe. Das nach dem Gleichgewichtsprincip construirte
Schieberventil läuft zwischen zwei parallelen Platten, wovon die eine mit den
Eingängen F, die andere mit einem nach dem Condensator
führenden Canal versehen ist.
Fig. 6 stellt
einen Dampfmaschinen-Regulator zum Theil im Aufrisse und zum Theil im
Durchschnitte dar. A ist eine zum Theil mit Wasser
gefüllte Vase, in die sich ein Cylinder C erstreckt; B eine im Cylinder C befindliche
Schraube, deren Spindel D durch den Boden der Vase geht.
Die Spindel D ist mit einer Leiste versehen, an welcher
die Büchse der Schraube frei auf- und niedergleitet. Die Leiste hat den Zweck
die Schraube gleichzeitig mit der Spindel in Rotation zu setzen. E ist eine an beiden Enden offene und an den Boden der
Vase befestigte Röhre, durch welche die Spindel D geht.
Diese Röhre hat den Zweck, zu verhüten daß die in der Vase enthaltene Flüssigkeit an
den Seiten der Spindel D hinabfließe; sie macht somit
eine Stopfbüchse entbehrlich. F ist ein loser Reif unter
dem Hals G. Dieser Reif besitzt zwei hervorragende
Stifte zur Aufnahme der Gelenke J, welche jede
auf- oder abwärts erfolgende Bewegung dem Hebel K
und von da dem Drosselventil mittheilen. H ist eine
zwischen den Hälsen I und G
befestigte spiralförmige Stahlfeder; L ein über der Vase
befestigter zugleich als Führung dienender Träger; M
eine mit einem Knopfe versehene Schraube, die dem oberen Ende der Spindel D als Lager dient; P ein an
die Spindel D befestigtes Treibrad; Q die Pfanne worin sich die Spindel dreht; R das Hauptrad; S die
Treibwelle im Durchschnitt; T die Bodenplatte. Bei U befindet sich eine Reihe von Scheibewänden in der
Vase, um soviel wie möglich zu verhüten, daß die in der Vase befindliche Flüssigkeit
mit der Schraube rotire. Eine Regulirung der Bewegung wird mit Hülfe dieses
Apparates auf folgende Weise erzielt. Indem die Schraube B durch die Achse D in Bewegung gesetzt wird,
wirkt sie augenblicklich mit ihrer Fläche auf die in der Vase befindliche
Flüssigkeit. Dadurch wird die Schraube aufwärts gedrückt und wirkt gegen die
Spiralfeder H, bis sie einen neutralen Punkt zwischen
ihrer Kraft und der Kraft der Feder findet. Dieser Punkt hängt von der
Rotationsgeschwindigkeit der Schraube ab; die geringste Zu- oder Abnahme in
der Geschwindigkeit ertheilt dem losen Ringe F und somit
auch den mit ihm verbundenen Theilen eine auf- oder niedergehende Bewegung.
Die aus dieser Anordnung resultirenden Hauptvortheile bestehen in der raschen und
sicheren Wirkung; denn sobald die Schraube um einen Grad schneller umgetrieben wird,
gleitet sie durch die umgebende Flüssigkeit wie durch eine Schraubenmutter in die
Höhe; läßt dagegen ihre Geschwindigkeit etwas nach, so gewinnt die Ausdehnsamkeit
der Feder die Oberhand und treibt die Schraube abwärts.
Die Figuren 7
und 8 stellen
ein verbessertes Drosselventil dar. A ist die
Ventilbüchse; B das obere Schiebventil; C das Drosselventil;
D die Spindel des letztern; E die Spindel des Schiebventils; F ein an die
Ventilbüchse befestigter Träger; G ein auf diesem Träger
sich drehendes Handrad, dessen Büchse mit Schraubenmuttergängen versehen ist. Eine
an das untere Ende der Büchse aufgeschraubte Mutter H
verhütet eine Hebung des Handrades. I ist eine kleine
Stopfbüchse am oberen Ende der Spindel E, um eine
Dampfentweichung rings um die Spindel D zu verhüten. J ist der durch das Ventil in die Dampfröhre führende
Canal; K die mit dem Dampfkessel communicirende Röhre.
Die Wirkung dieses Ventils ist folgende. Wenn das Ventil geöffnet werden soll, so
muß das Handrad in der geeigneten Richtung umgedreht werden, um die Schraube an der
Spindel E aufwärts zu ziehen; durch Umdrehung des Rades
nach der andern Richtung drückt die Schraube das Ventil abwärts und schließt es. Die
Spindel D und das Ventil C
werden durch einen Regulator in Thätigkeit gesetzt.
Die Figuren 9
und 10
stellen eine andere Einrichtung des Drosselventils dar. A ist der Hauptkörper des Ventils; B der
Deckel; C die Spindel zum Oeffnen des Ventils; D ein auf das Ende der letzteren geschobener loser Hals;
E ein durch das Ende der Spindel gesteckter Keil, um
dieselbe an ihrer Stelle zu erhalten. F, F sind mehrere
Oeffnungen in den Körper A; G, G correspondirende
Ventilsitze an dem Hauptkörper A und dem Ventildeckel;
H, H ähnliche Ventilsitze. I,
I eine von dem Ventildeckel B hervorragende
Lippe; J der Hauptausgang. Dieser ganze Apparat ist im
Innern eines Dampfkessels zu befestigen.
Tafeln