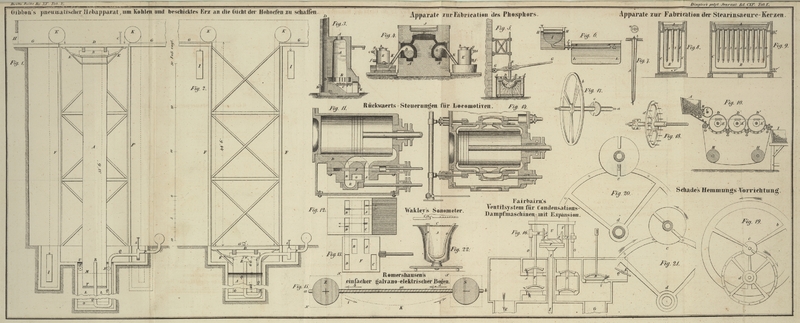| Titel: | Ueber das Gießen der Stearinkerzen und ihr Poliren mittelst der Maschine; von Prof. Payen. |
| Fundstelle: | Band 115, Jahrgang 1850, Nr. XIV., S. 63 |
| Download: | XML |
XIV.
Ueber das Gießen der Stearinkerzen und ihr
Poliren mittelst der Maschine; von Prof. Payen.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Payen, über das Gießen und Poliren der Stearinkerzen.
Im polytechn. Journal, Jahrgang 1848, Bd. CX S. 106 wurde die Fabrication der
Stearinsäurekerzen mitgetheilt, wie sie Dumas in seinem
Handbuch der angewandten Chemie beschreibt; was dieser Beschreibung Payen in seinem Précis de
Chimie industrielle, Paris 1849, beifügt, betrifft im Wesentlichen nur das
Gießen und Poliren solcher Kerzen.
Gießen der Stearinkerzen. Die festen und weißen Brode von
Stearinsäure, aus welchen Kerzen gegossen werden sollen, muß man zuerst bei der
Temperatur des siedenden Wassers umschmelzen, nämlich in einem kupfernen Kessel mit
doppeltem Boden, welcher durch Dampf erhitzt wird. Gewöhnlich setzt man der
Stearinsäure 3 bis 5 Procent WachsProf. Knapp gibt in seinem Lehrbuch der chemischen
Technologie, 1847 Bd. I, den Wachszusatz zu 1 1/2 bis 2 Procent an, welches
Verhältniß in Deutschland wohl nicht überschritten wird. zu, welches ihre Krystallisation verworrener macht und verhindert daß die
Kerzen zu zerreiblich ausfallen.
Die metallenen Lichtformen sind den gewöhnlichen ähnlich, nur ist der Trichter (die
Kapsel) auf deren oberen Oeffnung größer, damit die darin zurückbleibende
geschmolzene Masse die Gase austreten läßt und die Form besser ausfüllt. Die jetzt
gebräuchlichen Formen haben einen einzigen Trichter (aus Weißblech) für dreißig
Kerzen (Fig.
7, 8 und
9). Man
befestigt den Docht am oberen Theil der Form mit einer kleinen durchbrochenen
Scheibe a, a' (Fig. 7), in deren Mitte
sich ein Loch zum Durchziehen des Dochts befindet, welcher durch einen an seinem Ende gemachten
Knoten zurückgehalten wird; am unteren Theil der Form A'
hält ein hölzerner Stift den Docht in der Richtung seiner Achse gespannt.
Diese Dochte sind zopfartig geflochten oder doch stark gedreht, damit man die Kerzen
nicht zu putzen braucht; in Folge des Flechtens und einer Drehung, welche man dem
Docht in dem Augenblick ertheilt wo man ihn mit dem Holzstift in der unteren
Oeffnung anzieht, muß er sich beim Abbrennen der Kerze schwach zur Seite biegen und
krümmen, so daß seine Spitze aus der Flamme hervorsieht und sich in Berührung mit
der Luft ununterbrochen einäschert. Dessenungeachtet könnte noch Asche von dem Docht
auf die Kerze gelangen und letztere beschmutzen; man hat es aber dahin gebracht, die
Asche so zu reduciren, daß sie unbemerklich wird: hiezu genügt es, die Dochte in
eine Auflösung von Boraxsäure zu tauchen. Diese Säure bildet mit dem Kalk und der
Kieselerde der Asche ein schmelzbares Glas, welches man am Ende des Dochts bei
seiner Verbrennung in Kügelchen glänzen sieht.In 1000 Gewichtstheilen Wasser löst man 3 Theile Boraxsäure auf und setzt
noch 5 Theile concentrirter Schwefelsäure zu; letztere erleichtert die
Einäscherung und trägt zum Krümmen des Dochts bei.
Nachdem die Dochte in der Achse der Formen befestigt sind, bringt man letztere in
Reihen von zwölf bis dreißig auf dem Trichter in den Heizapparat womit ihre
Temperatur erhöht wird. Dieser Apparat A, B (Fig. 8 und 9) besteht aus
Kästen von Eisenblech mit doppelter Hülle C, C, von
denen jeder dreißig Formen aufnimmt; letztere sind mit einem Luftbad umgeben,
welches mittelst eines in die doppelte Hülle C, C
strömenden Dampfstrahls auf der Temperatur des siedenden Wassers erhalten wird.
Durch einen Hahn r kann man die Luft aus der doppelten
Hülle entweichen lassen; der Hahn r' dient zum Ablassen
des condensirten Wassers.
Sobald die Formen warm genug sind (etwa 36° R.), bringt man sie auf ein
Gestell aus Holz und füllt sie mittelst eines Löffels mit langem Schnabel; man muß
Stearinsäure anwenden, welche vorher geschmolzen wurde und zu krystallisiren
beginnt: diese Vorsichtsmaßregel und das Erwärmen der Formen sind nöthig, damit die
fette Säure dickflüssig laufen und die Formen anfüllen kann ohne zu gestehen, dann
aber fast augenblicklich so rasch krystallisirt, daß man eine verworrene und
feinkörnige Krystallmasse erhält.
Nach dem Erkalten der Formen nimmt man den Holzstift weg, welcher den Docht
zurückhält und zieht die Kerzen heraus; man bricht das Uebergußstück ab und
schneidet den Docht unter der kleinen Scheibe weg. Die Abfälle werden in einem mit
Silber plattirten Kessel mittelst Weinsteinsäure gereinigt und dann direct zum
Gießen von Kerzen angewandt.
Die gegossenen Kerzen müssen einige Zeit dem Licht und der Feuchtigkeit ausgesetzt
werden, damit sie ganz weiß werden. In den Städten, wo der Platz beschränkt ist,
kann hiezu ein auf den Fabrikgebäuden errichteter Altan mit Vortheil benutzt
werden.
Poliren der Kerzen. Endlich
müssen die Kerzen noch beschnitten und polirt werden, was mittelst einer sehr
einfachen Maschine Fig. 10 geschieht. Man legt die Kerzen alle in derselben Richtung in dem
Trichter (Rumpf) A in Schichten über einander; eine
cannelirte Walze B nimmt eine nach der andern auf und
führt sie bei ihrer Umdrehung vor die Kreissäge C,
welche sie abschneidet und auf ein endloses Wollentuch fallen läßt, welches durch
die Rollen G, G, G gehalten wird und unter den Walzen
H, H hinzieht. Während die den Rollen und Walzen
ertheilte rotirende Bewegung das Wollentuch in Circulation setzt, werden zugleich
drei andere Walzen, D, D', D'', welche mit Wollenzeug
überzogen sind, in der entgegengesetzten Richtung bewegt, nämlich durch die drei
Getriebe E, E', E'', welche drei auf einer
gemeinschaftlichen Achse befindliche endlose Schrauben umdrehen.
Die rotirende Bewegung aller Walzen und Rollen trägt dazu bei, daß die Kerzen
vorschreiten, indem sie sich selbst rollen, von dem Augenblick an wo sie unter die
Säge C fallen bis zur letzten Rolle G welche sie in den Recipient I abgibt. Da übrigens die drei Walzen D, D',
D'', sowie ihre Getriebe und endlose Schraube, auf einem beweglichen Gestell
angebracht sind, so erhalten sie eine rasche Hin- und Herbewegung in der
Richtung ihrer Achse. Man begreift daher, daß die Kerzen, indem sie zwischen zwei
Wollengeweben rollen, auf ihrem ganzen Woge in der Längenrichtung gerieben werden,
folglich glatt und polirt in den Recipient gelangen, aus welchem man sie zum
Verpacken herausnimmt.
Tafeln