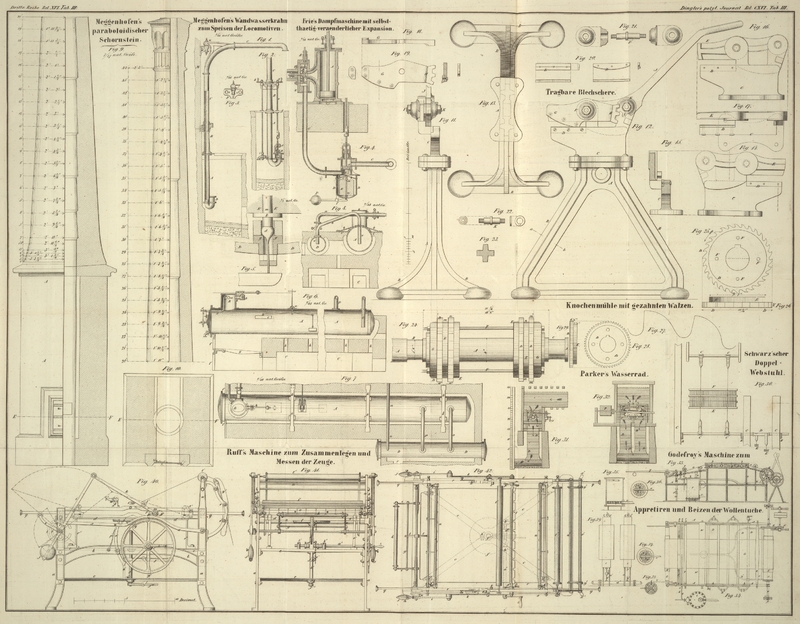| Titel: | Beschreibung einiger technischen Constructionen der Main-Neckareisenbahn und Main-Wesereisenbahn auf Frankfurter Gebiete; von Dr. Adolph Poppe. |
| Autor: | Dr. Adolph Poppe [GND] |
| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXXI., S. 169 |
| Download: | XML |
XXXI.
Beschreibung einiger technischen Constructionen
der Main-Neckareisenbahn und Main-Wesereisenbahn auf Frankfurter Gebiete;
von Dr. Adolph
Poppe.
(Fortsetzung von Bd. CXV S. 180.)
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Poppe's Beschreibung einiger technischen Constructionen der
Main-Neckar- und Main-Wesereisenbahn.
II.Wandwasserkrahn auf dem
Main-Weser-Eisenbahnhofe zu Frankfurt.
Bei Gelegenheit des im ersten Februarhefte dieses Jahrgangs des polytechnischen
Journals beschriebenen Vorwärmers wurde bemerkt, daß das Wasser des Reservoirs durch
eine unterirdische Röhrenleitung zwei freistehenden Krahnen und einem Wandkrahn
zugeführt werde. Da dieser Wandkrahn durch eine vortheilhafte Construction und
Anordnung der Absperrungsventile sich empfiehlt, so lasse ich die Beschreibung und
Abbildung desselben folgen.
Fig. 1 stellt
den Wand-Wasserkrahn in der Seitenansicht, mit theilweisem Durchschnitte und
ohne Ventil, Fig.
2 den unteren Theil desselben mit dem Ventil und dem Ablaßhahn in der
Seitenansicht mit theilweisem Durchschnitte dar. Der Krahn besteht aus drei Theilen,
nämlich aus dem unter dem Planum der Eisenbahn liegenden Röhrenstück A, welches sich der Wasserleitung anschließt, aus der
hohlen Säule B, die sich mit ihrem unteren Ende an die
Röhre A schließt, mit ihrem oberen Ende aber an die
Mauer M befestigt ist, und endlich aus dem beweglichen
Theile oder dem Schnabel C, C. Die Wendung des Krahns
erfolgt oben um eine starke Angel a, welche vermittelst
zweier langer durch die
ganze Mauerdecke gehender Schraubenbolzen an die Mauer befestigt ist; unten dreht
sich der Krahn vermittelst einer gewöhnlichen Stopfbüchse in der Säule B. Das Wasser tritt aus der unterirdischen Röhrenleitung
in die Ventilbüchse D und steigt durch die Röhre A und die Säule B in den
beweglichen Theil des Krahns. Zur Absperrung des Wassers dient das Kegelventil c, welches die bei Gelegenheit des Vorwärmers im ersten
Februarheft S. 179 erwähnte vortheilhafte Einrichtung hat. Die Ventilspindel tritt
durch eine Stopfbüchse ins Freie und ist mit Schraubengängen versehen, die in einer
Mutter d laufen. Das obere viereckige Ende der
Ventilspindel wird von einem Schlüssel umfaßt, dessen Stange e, e bei f durch eine Führung und oben durch
das Lager eines an die Säule B gegossenen Trägers tritt.
Die Schlüsselstange wird mit Hülfe eines an einem kleinen Handrade g befindlichen Kurbelgriffes nach der einen oder der
andern Richtung in Umdrehung gesetzt, je nachdem das Ventil c geöffnet oder geschlossen werden soll. h ist
ein zweites dem ersteren gegenüber angeordnetes Handrad, durch dessen Umdrehung ein
an dem unteren Ende der Röhre A befindlicher Ablaßhahn
i geöffnet werden kann, um im erforderlichen Falle
das in dem Krahn stehende Wasser abzulassen. Fig. 3 stellt die oben
erwähnte Angel in größerem Maaßstabe in der vorderen Ansicht dar. k ist die an die Tragplatte P gegossene Pfanne, welche den conischen nach der Mittellinie der Röhre
B centrirten Stahlzapfen des Schnabels aufnimmt; s, s sind die Muttern zu den beiden durch das Mauerwerk
gehenden Schraubenbolzen, womit die Tragplatte P an die
Mauer befestigt wird.
III.Dampfmaschine mit
selbstthätig-veränderlicher Expansion auf dem
Main-Neckar-Eisenbahnhof zu Frankfurt.
Zum Betrieb der Speisungspumpen, Drehbänke und anderer Maschinen und Apparate
befindet sich in der Werkstätte des Bahnhofs eine aus der Fries'schen Maschinenfabrik in Frankfurt (Sachsenhausen) hervorgegangene
Dampfmaschine von sechs Pferdekräften, mit selbstthätig-veränderlicher
Expansion. Der Cylinder dieser Maschine hat 10 Zoll Durchmesser, die Länge des
Kolbenhubes beträgt 24 Zoll und die Kolbenstange, welche, wie dieses bei kleineren
Dampfmaschinen gewöhnlich der Fall ist, durch eine Lenkstange mit der Kurbel in
directer Verbindung steht, wird durch eine Gegenlenkung senkrecht geführt. Der
Centrifugal-Regulator befindet sich dicht unter der Kurbelwelle, von welcher er
mittelst conischen Eingriffes unmittelbar in Bewegung gesetzt wird. Seine Bewegungen
reguliren nicht das gewöhnliche Drosselventil, sondern den Expansionsschieber und
zwar so, daß wenn die Schwungkugeln in Folge gesteigerter Geschwindigkeit zu weit
aus einander fliegen, der Schieber bei weniger als 1/4, im entgegengesetzten Falle
bei mehr als 1/4 des Kolbenhubes absperrt. Da die Maschine selbst nichts wesentlich
Neues darbietet, so möge diese kurze Andeutung ihrer Einrichtung genügen; den
Cylinder nebst Steuerung sieht man übrigens in Fig. 4, auf die ich unten
zurückkommen werde, im Verticaldurchschnitte abgebildet. Bemerkenswerth und neu ist
dagegen ein mit der Maschine in Verbindung stehender Apparat zur EntfernungEntfernuug des aus dem Dampfkessel mit dem Dampf fortgerissenen, sowie des in der
Röhrenleitung und dem Steuerungskasten durch Condensation gebildeten Wassers.
Außerdem verdient die Construction und Lagerung des Dampfkessels sowie die
Construction des Schornsteins nähere Erwähnung.
1) Apparat zur Auffangung und Entfernung des mit dem Dampf
fortgerissenen Wassers und des in den Dampfleitungsröhren sich bildenden
Condensationswassers. Einen schon vielfach besprochenen, aber seither noch
nicht zur Genüge beseitigten Uebelstand bildet bei Dampfmaschinen das Wasser,
welches aus dem Dampfkessel mit dem Dampf mechanisch fortgerissen wird, seinen Weg
durch den Cylinder nimmt, und öfters auf den Gang der Maschine störend einwirkt. Hr.
Ingenieur Meggenhofen hat
diesen Uebelstand durch Einschaltung eines einfachen Apparates in die
Dampfleitungsröhre zwischen dem Cylinder und dem Kessel auf eine wirksame Weise
beseitigt. Fig.
4 stellt den Dampfcylinder und die Dampfleitungsröhre mit dem
eingeschalteten Apparate im Verticaldurchschnitte dar. A
ist der Dampfcylinder; B die Expansionssteuerung; C, C die Dampfleitungsröhre; a ein Absperrungsventil, welches von dem Maschinenaufseher auf und nieder
geschraubt werden kann. Mit der Röhrenleitung C, C steht
ein Cylinder D, D in Verbindung, welcher dem durch
Condensation oder Ueberspritzen sich bildenden Wasser als Sammelbehälter dient. b, b ist eine an die Wand dieses Behälters geschraubte
nach oben conisch zulaufende Scheibe. Zwischen der Peripherie dieser Scheibe und dem
Behälter ist ein schmaler Zwischenraum gelassen, durch den das übergespritzte Wasser
in den Behälter fließt. In diesem befindet sich ein großer cylindrischer Schwimmer
E aus Sandstein, welcher an einem langen
Schraubenbolzen m, m, der seine Achse bildet, befestigt
ist.Hr. Meggenhofen hat den
Sandstein einem hohlen metallenen Schwimmer aus denselben Gründen
vorgezogen, aus welchen für die Schwimmer der Dampfkessel gegenwärtig
allgemein Steine angewandt werden, die ihrem Zwecke sicherer entsprechen als
hohle Metallschwimmer. Das Ende des Schraubenbolzens m, m gleitet in
einer an der conischen Scheibe b, b befestigten Führung
c, das untere Ende desselben enthält ein kleines
stählernes Kugelventil, welches eine in der Mitte des Behälterbodens angebrachte
Oeffnung verschließt. Die Ventilspindel erstreckt sich durch diese Oeffnung abwärts
und stützt sich auf das Ende eines zweiarmigen Hebels, der seinen Stützpunkt in f hat und an seinem langen Arm ein Gegengewicht P trägt. Die Einrichtung des Ventils ist aus der in
natürlicher Größe dargestellten Abbildung Fig. 5 deutlich zu
entnehmen. E, E ist das untere Ende des
Sandsteinschwimmers; k der Ansatz am langen
Schraubenbolzen, worauf der Schwimmer ruht; d das
stählerne Kugelventil; g, g der in den Boden des
Behälters geschraubte Ventilsitz aus Lagerguß.
Die Wirkungsweise des Apparates ist nun folgende. Angenommen, der Behälter D, D sey von Wasser leer, so wird das Kugelventil
geschlossen seyn, weil das Uebergewicht auf der Seite des Schwimmers sich befindet.
Wird nun das Absperrungsventil a geöffnet, so strömt der
Dampf in die Maschine; das durch Condensation etwa entstehende, besonders aber das
aus dem Kessel überspritzende Wasser wird sich in dem Behälter D, D, welcher die tiefste Stelle der Röhrenleitung
einnimmt, nach und nach sammeln. Mit dem zunehmenden Wasser muß aber der Sandstein
vermöge seines Gewichtsverlustes im Wasser sich heben; die Ventilöffnung wird frei,
und das Wasser spritzt durch die erwähnten Seitenöffnungen so lange heraus, bis das
Kugelventil wieder auf seinen Sitz herabgesunken ist. Der kurze Röhrenansatz e, der übrigens nicht unumgänglich nöthig ist, hat den
Zweck, das überspritzende Wasser um so sicherer in den Behälter zu leiten.
Dieser einfache Apparat versieht seit länger als einem Jahre seine Dienste zur
vollkommenen Befriedigung, indem er Steuerung und Cylinder stets trocken erhält.
2) Construction und Lagerung des Dampfkessels. Fig. 6 stellt
den zu der erwähnten Maschine gehörigen Dampfkessel im senkrechten
Längendurchschnitt, Fig. 7 im Grundriß und Fig. 8 im senkrechten
Querdurchschnitte dar. Gleiche Buchstaben dienen in diesen Figuren zur Bezeichnung
entsprechender Theile. A, A ist der 25 Fuß lange und 2 1/2 Fuß im lichten
Durchmesser haltende Dampfkessel; B die Dampfkuppel, aus
welcher der Dampf durch die Röhre a in die Maschine
geleitet wird; b das Sicherheitsventil; c ein zur Bezeichnung des Wasserstandes dienender
Schwimmer; m die Achse des Schwimmerhebels, welche
außerhalb des Kessels einen Indicator trägt; d, d der
gläserne Wasserstandszeiger.
Die obere Communicationsröhre des letzteren mündet sich nicht, wie gewöhnlich,
unmittelbar in dem Dampfraum des Kessels selbst, sondern vermittelst einer
Fortsetzung e, e oben in der Dampfkuppel, wodurch der
wirkliche Wasserstand im Dampfkessel auf eine zuverlässigere Weise außerhalb des
Kessels sich darstellt. f, f ist die gußeiserne
Vorstellplatte des Ofens; g, g der Rost; h, h, h.... sind Oeffnungen in der Untermauer, durch
welche die Flugasche in den an beiden Enden temporär zugemauerten Raum C, C fällt.
Sehr zweckmäßig ist die Art der Lagerung des Dampfkessels. Er wird vermittelst einer
Art Hängwerk von der äußeren Rauhmauer des Ofens getragen, ohne auf die innere aus
feuerfesten Steinen construirte Futtermauer einen Druck auszuüben. i, i,
Fig. 8, sind
nämlich zwei 4 1/2 Zoll breite und 1 Zoll dicke eiserne Querschienen, welche auf
eine solide Weise an das äußere Mauerwerk befestigt, an ihren inneren bis zu 8 Zoll
sich erweiternden Enden aber concentrisch zum Dampfkessel aufwärts gebogen sind. An
diese Enden wird der Dampfkessel, wie aus Fig. 8 am deutlichsten zu
entnehmen ist, festgenietet. Eine eiserne Verstrebung k,
k von der nämlichen Breite und Dicke, wie die Schiene i, i und gleichfalls mit dem Kessel vernietet, gibt der
ganzen Aufhängung noch größere Festigkeit. An drei solchen eisernen Verstrebungen
hängt der Dampfkessel, dessen vorderes Ende auf der Vorstellplatte f, f ruht. In Folge dieser Anordnung können mit der
Futtermauer des Ofens Reparaturen und Veränderungen vorgenommen werden, ohne daß die
Lage des Dampfkessels im geringsten verändert zu werden braucht.
Das Speisungswasser wird durch die Röhre n, n nicht
direct in den Kessel A, A, sondern zunächst in einen
kleineren 10 Fuß langen und 1 1/2 Fuß inneren Durchmesser haltenden Vorwärmkessel
D, D geleitet. Dieser wird von dem Ofen des
Hauptkessels aus mittelst Canälen geheizt, welche die heiße Luft unter und neben ihm
hinwegleiten, ehe sie in den Schornstein entweicht. Der Vorwärmer, dessen höchste
Stelle unterhalb der Wasserlinie des Hauptkessels liegt, steht durch zwei heberartig
gebogene Röhren o, o und p,
p mit dem Hauptkessel in Verbindung. Die Röhre o,
o geht von der Mitte des Vorwärmers aus und erstreckt sich bis unter die
Mitte des Hauptkessels; durch sie strömt das vorgewärmte Wasser in den letztern. Die
andere Röhre mündet sich in beide Kessel an ihrer höchsten Stelle, ohne sich weiter
in das Innere derselben zu erstrecken; sie führt den an der Decke des Vorwärmers
etwa sich bildenden Dampf in den Hauptkessel und stellt in beiden Kesseln die
gleiche Dampfspannung her. r ist die in den Schornstein
führende Oeffnung.
3) Der paraboloidische Schornstein. Bei der Construction
des zu dem erwähnten Dampfkesselofen gehörigen Schornsteins stellte Hr. Meggenhofen sich die Aufgabe,
Dauerhaftigkeit und Festigkeit mit einer eleganten Form zu vereinigen, und diesen
Zweck hat er dadurch auf eine sehr befriedigende Weise erreicht, daß er dem
Schornstein die Gestalt eines parabolischen Conoides gab.
Fig. 9
stellt den Schornstein zur Hälfte im Verticaldurchschnitt, zur Hälfte in der
Seitenansicht dar. Fig. 10 gibt einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie EF von Fig. 9. Der ganze 64 Fuß
hohe Schornstein gewährt den Anblick einer schlanken Säule von ausnehmend gefälliger
und eleganter Form. Seitwärts vom Dampfmaschinengebäude erhebt sich das viereckige
Piedestal A, A, und auf diesem der paraboloidische
Schornsteinschaft. Das aus weißem Sandstein gemauerte Piedestal ist 16 Fuß hoch und
mißt 7 Fuß im Geviert. Der Schornsteinschaft ist mit seinem steinernen Aufsatz 48
Fuß hoch und aus eigens für ihn geformten Backsteinen gemauert. Der cylindrische mit
feuerfesten Steinen ausgefütterte Canal im Piedestal hat 2 Fuß Durchmesser; vom
oberen Ende des Piedestals bis zum Schornsteinaufsatz vermindert sich diese Weite in
Absätzen bis auf 15 Zoll. Die Dicke des Backsteingemäuers beträgt am unteren Ende 2
Fuß 4 Zoll, am oberen, d.h. an der Schornsteinmündung, worauf der Aufsatz ruht, nur
7 Zoll. Sämmtliche Steinschichten sind gegen innen geneigt; doch ist die Neigung der
unteren Schichten größer und vermindert sich gegen oben in der Art, daß die
Backsteine überall zu der mittleren Drucklinie normal stehen.
Die gegebene Höhe des Schornsteinschaftes vom Piedestal bis zum Aufsatz = 44 Fuß, der
gegebene Halbmesser = 3 Fuß 4 1/2 Zoll am Fuß und der Halbmesser = 1 Fuß 2 1/2 Zoll
an der Mündung desselben, bildeten die zur Berechnung der erzeugenden Parabel
erforderlichen Elemente. Da die Höhe des Schaftes = 44 Fuß als die begränzende
Abscisse und die Differenz des Halbmessers an der Basis und des Halbmessers an der
Mündung des Schaftes = 2 Fuß 2 Zoll als begränzende Ordinate zu betrachten ist, so
liefert dieses für den Parameter den Werth
p = y²/x = 169/1584 Fuß,
mit dessen Hülfe nun die zu den Abscissen gehörigen Ordinaten,
in der Nähe des Scheitels von Zoll zu Zoll, dann von 1/2 Fuß zu 1/2 Fuß und endlich
von Fuß zu Fuß berechnet wurden. So fand man z.B. die zu einer Abscisse von 20 Fuß
gehörige, d.h. die einer Höhe von 20 Fuß über dem Piedestal entsprechende
Ordinate
y = √px = √(3380/1584) = 1 Fuß 5 1/2 Zoll.
Mit Hülfe der Ordinaten konnte nun der Halbmesser jedes Querschnittes des
Säulenschaftes in jeder Höhe über der Basis bestimmt werden, indem man nur die
berechnete Ordinate von dem Halbmesser des Schaftes an seiner Grundfläche, d.h. von
3 Fuß 4 1/2 Zoll abzuziehen brauchte. So ergab sich z.B. für die erwähnte Höhe von
20 Fuß der Halbmesser des Querschnittes = 1 Fuß 11 Zoll. Es wurde nun eine Anzahl
kreisrunder hölzerner Scheiben angefertigt, welche den berechneten Querschnitten des
Schornsteins von Strecke zu Strecke, z.B. von 4 zu 4 Fuß entsprachen; eben so wurden
hölzerne Schablonen angefertigt, deren eine Seite nach dem Parabelstück geformt war,
welches zwischen je zwei Querschnitten des Schornsteins lag. Nachdem auf der oberen
Fläche des Piedestals der Umfang der Basis des Paraboloides concentrisch zu dem
cylindrischen Schornsteincanal gezeichnet worden war, wurde die erste Scheibe in
horizontaler Lage genau nach der Achse des Schornsteins centrirt und an das
Baugerüst befestigt. Indem nun die parabolische Schablone in gehöriger Lage rings um
die Scheibe und den unteren Begränzungskreis angelegt wurde, konnten die Backsteine,
von denen die äußeren schon zum voraus nach der Krümmung der Schablonen
schichtenweise geformt waren, ohne Schwierigkeit in der richtigen Lage über einander
geschichtet und ihre äußere Fläche mit der Fläche des Paraboloides in
Uebereinstimmung gebracht werden. Als das Mauerwerk bis zur ersten Scheibe
aufgeführt war, wurde etwa 4 Fuß höher die nächste für diese Höhe construirte
Scheibe auf gleiche Weise centrirt, befestigt und mittelst Anlegung der zweiten
Schablone die folgende Mauerschichte aufgeführt und so fortgefahren.
Als ein Beweis, welchen Beifall diese elegante Schornsteinconstruction gefunden hat,
mag hier erwähnt werden, daß kurz nach Vollendung derselben ein zweiter 104 1/2 Fuß
hoher paraboloidischer Schornstein in der Zimmer'schen
Chininfabrik in Sachsenhausen von dem Maurermeister Hrn. Schaffner in sehr gelungener Weise aufgeführt
wurde, und daß zu
einem dritten für die Maschinenwerkstätte des Main-Weser-Bahnhofs
bestimmten Schornstein dieser Art die Zeichnung bereits angefertigt ist.
(Fortsetzung folgt.)
Tafeln