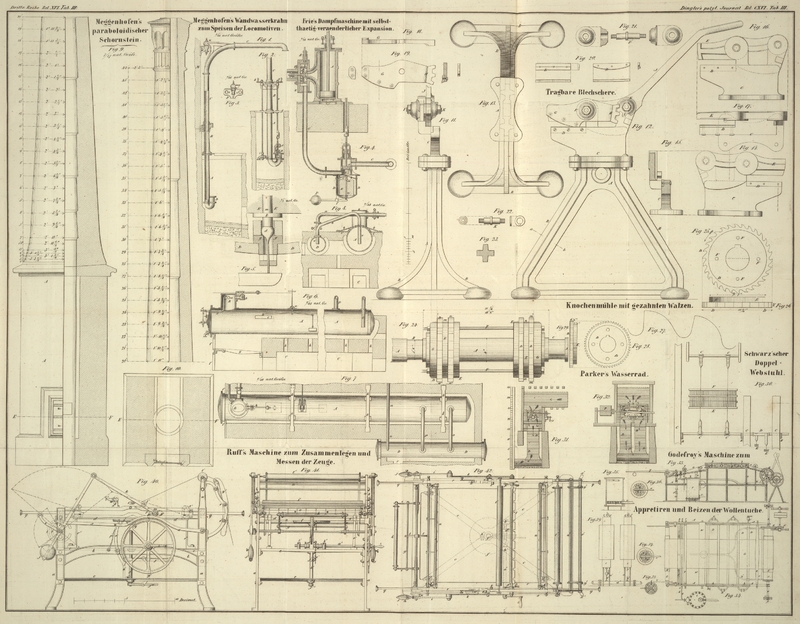| Titel: | Maschine zum Appretiren und zum Beizen der Wollentuche, welche sich Peter Godefroy zu London, am 16. Jan. 1849 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XXXVII., S. 188 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Maschine zum Appretiren und zum Beizen der
Wollentuche, welche sich Peter
Godefroy zu London, am 16. Jan.
1849 patentiren ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Februar
1850, S. 75.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Godefroy's Maschine zum Appretiren und zum Beizen der
Wollentuche.
Meine Erfindung betrifft ein Verfahren, den Tüchern Preßglanz zu ertheilen, ferner
eine Methode, den Farbstoff, womit der Zeug imprägnirt wurde, mittelst eines
dampfförmigen Beizmittels zu fixiren.
Bei der gewöhnlichen Appretirmethode wird die Appretur in einer Presse mit
gleichzeitiger Anwendung von Wärme hervorgebracht. Diese Behandlung macht das Tuch
nicht nur hart und ungeschmeidig, sondern bei der nothwendigen Zwischenlage von
Preßspänen etc. veranlassen die in dem Fabricat enthaltenen Substanzen Entfärbungen
und Flecken auf dem Tuch.
Fig. 33
stellt den Appretirapparat in der Seitenansicht, Fig. 34 im Grundrisse
dar. A, A ist das Hauptgestell, welches die Einrichtung
hat, daß das zu bearbeitende Fabricat von einer Walze an dem einen Ende in die
Maschine geleitet, und am andern Ende der Maschine wieder von einer Walze
aufgenommen wird. B, B ist die Zuführwalze, C, C die Aufnehmwalze. An dem oberen Theil des Gestells
A, A ist eine Reihe von Metallröhren D, D in Lagern a, a, a
angeordnet. Diese Röhren müssen an der Oberfläche glatt seyn, und wenn die Beize
sauer ist, oder aus einer Säure besteht, so müssen sie aus einem Metall angefertigt
oder mit einem Metall überzogen seyn, welches von der Säure nicht angegriffen wird.
Sämmtliche Röhren D, D sind durch E, E verbunden, so daß, wenn man Dampf oder heißes Wasser durch die Röhre
F einströmen läßt, dasselbe durch die ganze
Anordnung circulirt und die Röhre D, D bis zur
geeigneten Temperatur erwärmt.
Die Einströmung des Dampfs oder heißen Wassers wird durch den an der Röhre F befindlichen Hahn regulirt, um die Temperatur auf dem
gehörigen Grad zu erhalten. Die letzte Röhre D des
Systems ist mit einer kleinen Röhre c versehen, durch
welche bei Anwendung des Dampfs das Condensationswasser abfließen kann, und der
Dampfhahn an dieser Röhre ist so eingerichtet, daß er eben nur die Entweichung des
Wassers gestattet. Die Speisewalzen B, B, deren eine
gewisse Anzahl vorhanden ist, sind so in die Lager d, d
eingepaßt, daß sie leicht entfernt werden können. Das zu bearbeitende Fabricat wird
zuerst aufgewickelt, indem es an das Ende eines die Walze umhüllenden Umschlages H, H befestigt wird.
Die Enden der hohlen metallenen Aufnehmwalze C, C werden
zwischen den Scheiben I, K centrirt; diese befinden sich
an Achsen L, L, deren äußere Enden in besondern Trägern
M, M gelagert sind, wodurch die gerade Richtung
beider Achsen L, L gesichert ist. Die Scheiben I, K sind mit einer Anzahl Löchern e, e zur Aufnahme einer entsprechenden Anzahl an den
Cylinderenden C, C befestigter Stifte f, f versehen. Diese Stifte und Löcher werden so in
einander gefügt, daß sie den Cylinder in einer zu den Achsen L, L centralen Lage erhalten. Die Achsen L, L
lassen sich in ihren Lagern der Länge nach verschieben. Durch diese Bewegung kann die Scheibe zum
Behuf der Abnahme oder Einfügung der Cylinder zur Seite geschoben werden.
Wenn ein Cylinder C, C in die Maschine eingesetzt werden
soll, so bringt man die Scheiben in die geeignete Lage, worin sie durch adjustirbare
mittelst Bindeschrauben an ihre Achse befestigte Hälse gehalten werden. Der Cylinder
wird durch die Scheibe K in Bewegung gesetzt. Diese ist
mit Zähnen versehen, welche in das an der Treibwelle O
sitzende Getriebe N greifen. Die Treibwelle, welche ihre
Bewegung von einer Dampfmaschine oder andern Triebkraft herleitet, ist mit den
nöthigen Ein- und Ausrückvorrichtungen versehen. P,
P ist eine kupferne Dampfvertheilungsröhre, deren obere Fläche siebartig
durchlöchert ist. Diese Röhre liegt horizontal unter dem Tuch G, G in Trägern i, i, die sich in Schlitzen im
Seitengestell A, A bewegen und mittelst Stellschrauben
k, k in der gehörigen Höhe adjustirt und befestigt
werden. In den Canal oder den Vertheiler P, P strömt
Hochdruckdampf durch die Röhre Q, welche der nöthigen
Adjustirung wegen mit einem verschiebbaren Theil i
versehen ist; eine Stopfbüchse m erhält die Verbindung
dampfdicht. Die Einmündung der Röhre Q in den Canal P sollte so angeordnet seyn, daß sie den Dampf so
gleichmäßig wie möglich vertheilt, und daß dieser überall in gleichem Maaße
entweicht. Deßhalb kann man die Anzahl oder Größe der Löcher an denjenigen Stellen,
wo das Bestreben des Dampfs zu entweichen am geringsten ist, vermehren. Die
Dampfröhre Q ist mit einer kleinen Verlängerung
versehen, durchweiche das durch Condensation erzeugte oder das vom Dampfkessel
übergeführte Wasser entfernt werden kann. R, R ist ein
anderer Dampfvertheiler, dessen Höhe mit Hülfe der Träger n,
n und der Stellschraube o, o regulirt werden
kann. Die Löcher dieses Vertheilers sind minder zahlreich und kleiner als diejenigen
des obigen Vertheilers; sie haben den Zweck, die Beize dem Zeug mitzutheilen. Die
Röhre S verbindet den Vertheiler R mit einem starken metallenen Behälter T, in
welchem die Beize in Dampfform verwandelt wird. Dieser Behälter ist in Fig. 35
abgesondert im Verticaldurchschnitt, Fig. 36 im Grundriß mit
Hinweglassung des Deckels, und Fig. 37 in der unteren
Ansicht mit Hinweglassung des Bodens dargestellt. Der Behälter T ist zur Aufnahme von Hochdruckdampf eingerichtet,
welcher durch die Röhre U einströmt. Er ist mit einem
Material, das von Säuren nicht angegriffen wird, überzogen; letzteres gilt auch von
den Röhren, durch welche die dampfförmige Beize strömt.
Wenn ich z.B. ein Wollentuch für Scharlachroth beizen will, so bereite ich die Beize
mit 2 1/2 Loth granulirtem Zinn, welches ich in einer mit 15 Pfund Wasser verdünnten
Mischung von 3/4 Pfund Salzsäure und 1/4 Pfund Schwefelsäure auflöse. Diese Mischung
kommt in ein Gefäß T, so daß sie dasselbe nicht weiter
als bis zu ungefähr 1/4 oder 1/5 ihres Rauminhaltes ausfüllt, wobei dafür zu sorgen
ist, daß sich stets eine hinreichende Menge Flüssigkeit in T befindet, um die Oeffnungen zu bedecken, durch die der Dampf in dieses
Gefäß tritt.
Diese Oeffnungen befinden sich an der unteren Seite der Röhren q, q und sind so angeordnet, daß sie den Dampf gleichmäßig über den
Querschnitt des Behälters T verbreiten. Durch die Kraft,
womit der Dampf aus den Röhren q, q eintritt und durch
seine abwärts gehende Richtung, wird ein fortwährendes Aufwallen in der Flüssigkeit
erzeugt, so daß die entweichenden Dämpfe mit dem Beizmittel geschwängert bleiben.
Die Dämpfe sammeln sich in einem sogenannten Separator, welcher bloß in einer Röhre
besteht, die an ihrer oberen Seite siebartig durchlöchert ist, um den Dampf an der
Oberfläche zu vertheilen und die Ueberführung der Flüssigkeit mit dem Dampf durch
die Röhre S nach dem Vertheiler R zu verhüten.
Dem Dampf gebe ich eine Temperatur von 88 bis 97° Reaumur, und um dieselbe in
dem Behälter T zu erhalten, erwärme ich ihn von außen
mittelst Gasflammen oder auf sonstige Weise. V, V ist
eine Walze um die Annäherung des Fabricates G, G an die
Dampfvertheiler P und R zu
reguliren. Diese Walze wird mit Hülfe der auf die Träger s,
s wirkenden Stellschrauben r, r adjustirt. W, W ist eine Fläche aus Plüsch, welche dazu dient, die
Oberfläche des Tuchs zu glätten. Diese glättende Fläche kann in gewissen Fällen
durch eine Bürste ersetzt werden, um die der Oberfläche des Fabricates anhängenden
fremdartigen Theilchen zu entfernen; auch kann man glättende Oberflächen in
verschiedenen Abstufungen gleichzeitig anwenden, wovon die Bürste als die rauheste
die erste bildet.
Die Wirkungsweise ist nun folgende. Das zu behandelnde Tuch wird auf die
Speisungswalze gewickelt und in die Lager d, d gebracht;
ein mit dem einen Ende an den Cylinder C, C befestigter
Umschlag X wird in der Richtung, welche das Fabricat zu
nehmen hat, rückwärts durch die Maschine geführt. Der mit diesem Umschlag verbundene
und auf die Walze B gewickelte Zeug nimmt nun, wenn die
Maschine in Gang kommt, seinen Weg mit abwärts gekehrter Vorderseite durch die
Maschine. Um das Tuch in gehöriger Spannung zu erhalten, ertheile ich mittelst der
Hebel Y der Zuführwalze B, B
Friction. Diese Walze ist von Holz und nur an ihren Enden mit metallenen Hälsen versehen, auf welche die
Frictionshebel wirken. Soll der Zeug seine Vollendung ohne Anwendung des Beizmittels
zum Färben erhalten, so wird der Dampf nur durch den Vertheiler P, P geleitet, und das darüber weggehende Tuch bis zu
einem gewissen Grad gleichförmig den Dämpfen ausgesetzt. Das Tuch bewegt sich sodann
unter der Walze V über die glättende Fläche W hinweg und nimmt von da seinen Weg abwechselnd über
und unter die geheizten Röhren D, D, welche die
Tuchfläche noch weiter glätten und zurecht legen, und wickelt sich endlich auf die
Walze C. Da das Tuch während dieser Operation an den
Sahlleisten ein größeres Streben sich zu spannen äußert als in der Mitte, so lasse
ich es unter einer Walze Z von ungleicher Dicke
wegziehen. Diese Walze bringt das Tuch auf seinem Weg nach der Walze C aus seiner geraden Richtung und ertheilt ihm in Folge
ihres zunehmenden Durchmessers eine gleichmäßige Spannung.
Während sich das Tuch auf der Walze C aufwickelt, setze
ich es noch dem Druck einer Walze C', C' aus. Diese
Walze ist in einem Rahmen D', D' gelagert, welcher um
eine der Spannschienen bei E' oscillirt, die das Gestell
verbinden, während der lange Arm des Hebels F
hinreichend belastet ist, um den erforderlichen Druck zu gewähren. Auf diese Weise
wird jede einzelne Tuchlage in feuchtem Zustande dem Druck ausgesetzt, wobei sie die
während des Processes ihr mitgetheilte Appretur beibehält. Um das Ende des auf die
Walze C, C gewickelten Tuchs vollständig einzuhüllen,
lasse ich den Umschlag H, H auf diese Walze sich
aufwickeln.
Auf diese Weise können Wollentücher, Seidenzeuge und andere Stoffe behandelt werden.
Die Preßwalze C', C' besteht aus Holz und ist mit Wolle
überzogen, wodurch der Zweck erreicht wird, ohne dem Tuch den Grad der Härte zu
ertheilen, welcher durch die Pressung zwischen harten und unnachgiebigen Flächen
hervorgebracht wird.
Wenn die Walze C, C mit Tuch gefüllt ist, so wird sie
abgenommen und in eine auf 97° Reaumur erwärmte Kammer gebracht. Außerdem
verbinde ich die Walzen, wovon in Fig. 39 zwei dargestellt
sind, mit den Heizröhren der Kammer, und lasse Dampf in sie einströmen. Die Walzen
ruhen in verticaler Lage auf Trägern a', a' und sind
durch Seitenröhren b', b' mit den Heizröhren d', d' der Kammer verbunden; jede Walze ist so
eingerichtet, daß diese Verbindung leicht ins Werk gesetzt werden kann. In dem
oberen Ende der Walze befindet sich ferner eine mit einem kleinen Hahn c' versehene Oeffnung, durch welche die in der Walze enthaltene kalte
Luft entweichen und dem von unten einströmenden Dampf Platz machen kann. In dieser
Kammer bleiben die Walzen mit dem Tuch, bis dieses vollkommen trocken ist, worauf es
von den Walzen abgenommen und auf die gewöhnliche Weise verpackt wird.
Für die zweite Abtheilung meiner Erfindung, nämlich das Imprägniren des Zeugs mit
dampfförmigem Beizmittel, ist die Thätigkeit der Maschine genau dieselbe wie die
beschriebene. Während der Operation läßt man gleichfalls Dampf durch den Behälter
T strömen, und leitet die in letzterem entwickelten
Dämpfe durch den Vertheiler R. Diese Dämpfe ziehen durch
das Tuch, welches in Folge seiner Bewegung über den Dampfvertheiler P bereits durch und durch angefeuchtet ist; war der Zeug
zuvor mit einem Farbstoff imprägnirt, so wird derselbe durch das dampfförmige
Beizmittel fixirt.
Tafeln