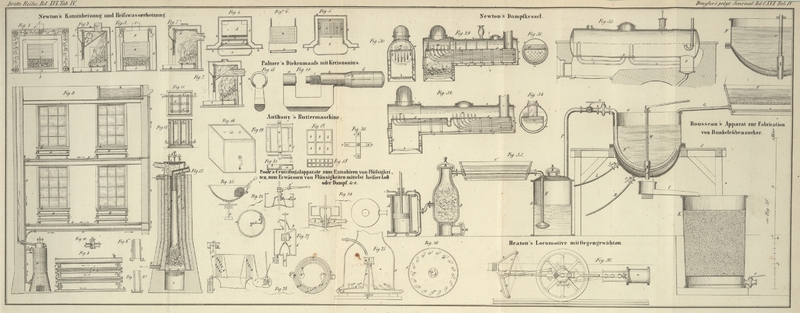| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich W. Newton, Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge am 17. April 1849 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. XLVII., S. 250 |
| Download: | XML |
XLVII.
Verbesserungen an Dampfkesseln, welche sich
W. Newton,
Civilingenieur in London, einer Mittheilung zufolge am 17. April 1849 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Februar 1850, S.
17.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Newton's Verbesserungen an Dampfkesseln.
Fig. 29
stellt einen Locomotivdampfkessel mit den an ihm angebrachten Verbesserungen im
senkrechten Längendurchschnitte und Fig. 30 im senkrechten
Querdurchschnitte durch die Mitte des Feuerkastens dar. Fig. 31 ist ein anderer
Querschnitt nach der Linie 1, 2 in Fig. 29; Fig. 32 ist ein
senkrechter Längendurchschnitt einer Abänderung dieser Locomotivkessel und Fig. 33 der
verticale Längendurchschnitt eines stationären Kessels nach demselben Princip. Fig. 34 stellt
einen Dampfkessel im Querschnitte dar, bei welchem die Röhren querüber anstatt der
Länge nach angeordnet sind.
Das der ersten Abtheilung dieser Erfindung zu Grunde liegende Princip und ihre
wesentliche Abweichung von allen andern Röhrenkesseln besteht darin, daß man die
Röhren, durch welche das Wasser circulirt, und die an beiden Enden in das Wasser des
Dampfkessels einmünden, an dem einen Ende aufwärts biegt. Dadurch wird der
ungleichen Ausdehnung der Röhren und der mit ihnen verbundenen Theile ein
hinreichender Spielraum ertheilt und eine raschere und vollkommenere Circulation des
Wassers über die Heizfläche des Metalls erzielt; der Erfolg ist, daß die Hitze
schnell aufgenommen wird und die Dampfentwickelung rasch stattfindet.
Der zweite Theil der Erfindung besteht darin, daß die erwähnte Biegung der Röhren da
angeordnet wird, wo die Hitze am stärksten ist, so daß das Wasser in einer dem
Feuerzuge entgegengesetzten Richtung circuliren muß. Der dritte Theil der Erfindung besteht
darin, daß man die Röhren durch die Platte, woran sie befestigt sind, hindurch bis
in die Nähe der Oberfläche des Wassers sich erstrecken läßt, wodurch die
Dampfentwickelung näher an diese Oberfläche gebracht wird.
a ist der Dampfkessel, b der
Feuerkasten. In dem Kessel ist ein System von Wasserröhren c angeordnet, welche mit ihrem hinteren Ende an eine senkrechte Platte d befestigt sind. Diese befindet sich in einem solchen
Abstande von der Endplatte e des Kessels, daß das Wasser
ungehindert in die Röhren dringen kann. Die anderen Enden dieser Röhren sind
aufwärts gebogen und an der Platte g befestigt. Letztere
ist an dem hinteren Ende mit der Platte d, an dem
vorderen Ende mit der Platte h, dann seitwärts mit den
oberen Rändern einer im Innern des Kessels befindlichen Platte verbunden, und zwar
in einem solchen Abstande, daß ringsherum ein Wasserraum j bleibt, welcher mit dem hinteren Raume f und
mit den Wasserräumen k communicirt. Die Platte i nebst der Decke g bildet
den in den Schornstein l führenden Feuercanal. Das Feuer
heizt auf seinem Wege nach dem Schornstein die Wasserröhren und die den Feuerraum
umhüllenden Platten g, h, i des Kessels. Indem das
erwärmte Wasser an den gebogenen Enden der Röhren in die Höhe steigt, wird eine
rasche Circulation durch die Röhren und den Kessel hervorgebracht, welche die Wärme
von der Oberfläche des Metalls rasch absorbirt. Da ferner die gebogenen Enden der
Röhren sich direct über dem Feuer befinden, so werden die Röhren an dieser Stelle
stärker erhitzt als weiter hinten, so daß die Richtung der Wassercirculation dem
Zuge des Feuers entgegengesetzt ist, wodurch die Absorption der Wärme durch das
Wasser vollständiger erfolgt. Um den Dampf näher an der Oberfläche des Wassers zu
erzeugen, erstrecken sich die gebogenen Röhren durch die Platte g hindurch bis nach m, Fig. 29 und
30.
Dadurch wird ein höherer Wasserstand über dieser Platte erzielt und die Gefahr vor
Explosionen vermindert; denn das Wasser kann bis unter die oberen Enden der Röhren
sinken, ohne die Circulation zu verhindern. Um behufs der Reinigung oder Reparatur
zu den Röhren gelangen zu können, ist die Kesselplatte bei n mit Löchern versehen, welche dem Kaliber der Röhren entsprechen, und an
dieser Stelle mit einer Platte o bedeckt.
Die Röhren können auch, anstatt in einer Länge von dem einen Ende des Kessels zum
andern, in zwei oder mehreren Abtheilungen, wie Fig. 32 zeigt, angeordnet
werden, deren gebogene Enden dem Ofen zugekehrt sind; oder man kann ihnen die Fig. 33
dargestellte Anordnung geben, wo sie dazu dienen, die verschiedenen Theile der Länge
eines cylindrischen
Dampfkessels zu verbinden. Die aufwärts gebogenen Enden der Röhren treten durch den
Boden des Kessels, und die horizontalen Enden sind mit dem Wasserbehälter p verbunden, welcher das Speisungswasser aufnimmt. Die
hinteren Röhrenenden können auch, wie bei q, aufwärts
gebogen und durch den Kesselboden geführt werden, während sich die vorderen Enden,
der Wassercirculation wegen, bis zu einer höheren Stelle des Kessels erstrecken.
Auch kann man die Röhren, wie Fig. 34 zeigt, in
transversaler Richtung anordnen.
Tafeln