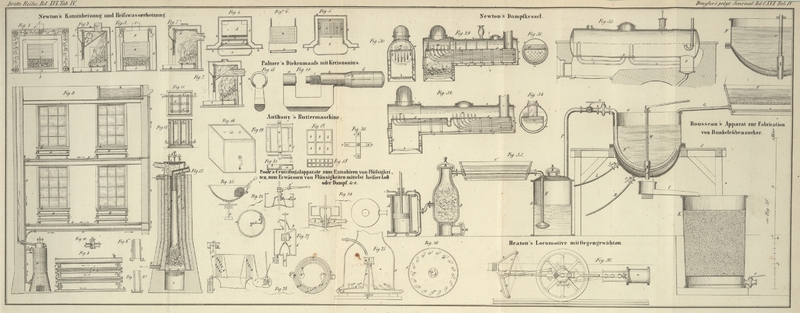| Titel: | Ueber Rousseau's neues Verfahren den Zucker aus den Runkelrüben vermittelst des Zuckerkalks zu gewinnen; von Professor Payen. |
| Fundstelle: | Band 116, Jahrgang 1850, Nr. LIX., S. 297 |
| Download: | XML |
LIX.
Ueber Rousseau's neues Verfahren den Zucker aus den
Runkelrüben vermittelst des Zuckerkalks zu gewinnen; von Professor Payen.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, März 1850, S. 132.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Payen, über Rousseau's Verfahren den Zucker aus Runkelrüben zu
gewinnen.
Im J. 1838 machte Hr. Kuhlmann
den Vorschlag, einen Ueberschuß von Kalk anzuwenden, um die Veränderungen des
Rübensaftes zu vermeiden und den Zucker besser zu reinigen. Er erhielt bei Versuchen
im Kleinen gute Resultate, indem er den Zucker in Zuckerkalk verwandelte, um während
des Abdampfens Veränderungen des Zuckers zu verhüten, welcher bekanntlich in seiner
Verbindung mit Kalk beständiger ist als im freien Zustande; er trennte dann den Kalk
durch Kohlensäure vom Zucker. Die Anwendung dieses Verfahrens im Großen schien ihm
schwierig zu seyn, obgleich er am Erfolg nicht verzweifelte.
Bis zum verflossenen Jahre hatte man auf diesem Wege im Großen kein vortheilhaftes
Resultat erhalten. Hr. Rousseau nahm alsdann die Versuche im Kleinen wieder auf und
bestimmte die günstigen Bedingungen des Erfolgs; er vereinigte seine Bemühungen mit
denjenigen eines unserer geschicktesten Maschinenbauer, des Hrn. Cail, und eines erfahrenen
Fabrikanten, des Hrn. Lequime,
welchen die Durchführung des Verfahrens im Großen bald gelang. Die merkwürdigen
ResultateUeber diese Resultate wurden bereits Daten im polytechn. Journal Bd. CXV S. 457 mitgetheilt., welche man während der letzten Campagne 1849–1850 in der
Zuckerfabrik zu Boucheneuille (Nord-Depart.) erhielt, lassen nach meiner
Meinung über die vortheilhafte Anwendbarkeit der nun zu beschreibenden Methode in
den Fabriken keinen Zweifel übrig.
Man gewinnt den Saft aus den Runkelrüben durch die gewöhnlichen Mittel (Waschen,
Zerreiben und Auspressen der Rüben). Die Läuterung des Safts geschieht in
gewöhnlichen Kesseln mit doppeltem Boden, welche durch Dampf geheizt werden; man
wendet beiläufig sechsmal soviel Kalk an als bisher, nämlich soviel, daß der Kalk
nicht nur auf die fremdartigen Bestandtheile des Safts wirken, sondern auch mit sämmtlichem in dem Saft
enthaltenen Zucker eine Verbindung bilden kann (den Zuckerkalk, welcher auf 2 Aeq.
Zucker 3 Aeq. Kalk enthält).
Es sind beiläufig 25 Kilogr. Kalk auf 1000 Liter Saft erforderlich; der gelöschte
Kalk wird mit seinem sechsfachen Gewichte heißen Wassers angerührt und dann mit dem
auf 48° Reaumur erwärmten Saft im Kessel N, Fig. 35,
vermischt; man steigert dann die Temperatur des Safts auf 72 oder nahezu 80°
R., ohne ihn zum Kochen zu bringen, um das Gerinnen des Zuckerkalks und (nach Rousseau) die Zersetzung einer stickstoffhaltigen
Substanz zu vermeiden.
Die durch den Hahn O abgezogene Flüssigkeit lauft auf ein
Filter P, welches in einer 20 Centimeter (7'' 4 1/2''')
dicken Schicht gekörnter Knochenkohle auf einem Plüschgewebe besteht; die von
demselben ablaufende Flüssigkeit ist klar, aber grünlichgelb; man leitet sie durch
das Rohr Q in einen Läuterungskessel G, der ihre Temperatur unterhält und in welchem die
Abscheidung des Kalks vorgenommen wird.
Der Apparat zur Fällung des Kalks mittelst Kohlensäure besteht in einer Druckpumpe
A, welche von der Dampfmaschine in Bewegung gesetzt,
beständig atmosphärische Luft unter den Rost eines geschlossenen Ofens B treibt, welcher in ellipsoidischer Form von
Schwarzblech verfertigt und innen mit einer Schicht von Tiegelerde oder Ziegeln
gefuttert ist.
Dieser Ofen wurde vorher auf dem Rost mit Holzkohlen und darüber mit Kohks beschickt,
deren Quantität etwa den fünften Theil vom Gewicht des zur Läuterung eines oder
mehrerer Kessel angewandten Kalks beträgt.
Die Holzkohle, welche gleich beim Beschicken des Ofens angezündet wird, theilt
vermittelst des durch die Pumpe eingetriebenen Luftstroms das Feuer den Kohks mit.
Diese Verbrennung erzeugt Kohlensäure (vorausgesetzt daß keine zu dicke
Kohlenschicht in Gluth kommt und Kohlenoxyd liefert), gemischt mit Stickstoff und
einem kleinen Ueberschuß von Sauerstoff, überdieß reißt das Gas Aschetheilchen und
einige verdichtbare Producte mit sich.
Diese gasförmige Mischung geht durch das Rohr E in ein
Waschgefäß D, worin sie auf ihrem Wege durch das
WasserDie Reinigung des Gases erfolgt noch leichter, wenn man es durch ein
Kühlgefäß C' leitet, in welchem kaltes Wasser
circulirt; dieses Kühlgefäß ist an dem Rohr C
angebracht und befindet sich zwischen dem Ofen und dem Waschgefäß. die festen Körperchen und die verdichtbaren Dämpfe absetzt.
Die gewaschenen Gase gelangen durch das Rohr F in ein
gemeinschaftliches Rohr F', welches sie mittelst Hahnen
a in jedem der Kessel G
vertheilt, die zu zwei Dritteln mit klarem geläutertem Saft gefüllt sind.
Das kohlensaure Gas tritt durch die Einschnitte F'' am
unteren Theil des Rohrs aus; es dringt in zahlreichen Blasen durch die Flüssigkeit
(welche eine Auflösung von Zuckerkalk ist) und erzeugt einen reichlichen
Niederschlag von kohlensaurem Kalk; die Sättigung der Flüssigkeit ist bald beendigt
und die überschüssige Kohlensäure entweicht zum Theil in die Luft.
Mit der Zersetzung der letzten Antheile von Zuckerkalk verschwindet die Klebrigkeit
der Flüssigkeit und es entsteht daher kein Schaum
mehr.
Man läßt die Flüssigkeit einige Minuten kochen, um die letzten Spuren überschüssiger
Kohlensäure zu verjagen, und läßt dann sogleich die trübe Flüssigkeit durch den Hahn
d auf ein Filter mit gekörnter Knochenkohle K auslaufen; der gefällte kohlensaure Kalk ist körnig,
und verhindert also das Filtriren nicht.
Der fast farblose zuckerhaltige Saft wird durch den Hahn e in die Abdampfkessel geleitet; man dampft ihn rasch auf 30 bis
31° Baumé abBei den folgenden Operationen scheint es zweckmäßiger zu seyn, das Abdampfen
nur bis auf 28° B. fortzusetzen und dann den Saft auf die Dichtigkeit
von 32° B. durch einen Zusatz von Zucker zu bringen; man nimmt hiezu
Zucker von der 2ten, 3ten oder 4ten Krystallisation, welcher im
Centrifugalapparat vom Syrup befreit und in demselben Apparat einmal mit
Klärsel behandelt worden ist. und bringt ihn dann zum zweitenmal auf die Kohlenfilter.
Der filtrirte Syrup ist weiß und klar; man verkocht ihn in den gewöhnlichen
Apparaten; man erhält in den blechernen Schüsseln einen Zucker, welcher weißer und
von reinerem Geschmack ist als der nach den bisherigen Methoden gewonnene; überdieß
ist die Ausbeute größer.
Der Tröpfelsyrup ist flüssiger; man kann ihn vier- und fünfmal nach einander
verkochen, wobei er jedesmal leicht abtropfende Krystalle gibt.
Das Decken dieser Producte mit Zuckersyrup geht auch mit großer Leichtigkeit von
Statten, so daß man jeden Tag den Zucker direct in der Raffinade ähnlichen Broden
erhalten kann.
Das Verfahren von Rousseau liefert also bei der Anwendung
im Großen schöne Producte, welche mit der gewöhnlichen Raffinade den Vergleich aushalten. Dazu
kommt noch, daß auf dem Schlangenrohr der Abdampfkessel fast gar keine Kalkkrusten
entstehen und daß man beim Verkochen keine Butter anzuwenden braucht, endlich daß
man gegen die bisherigen Methoden etwa 33 Procent an Knochenkohle erspart.
Beschreibung der Abbildung.
A, Fig. 35, Druckpumpe,
welche durch die Dampfmaschine in Bewegung gesetzt wird und mit dem Ofen aus
Schwarzblech B communicirt, der mit Holzkohlen und Kohks
beschickt wird. C' Kühlapparat, welcher einerseits mit
dem Ofen durch das Rohr C communicirt und andererseits
mit dem Waschgefäß D mittelst des Rohrs E, welches in die Flüssigkeit taucht und sich mit einer
Brause endigt. F Rohr im Deckel des Waschgefäßes,
welches gekrümmt ist und in den Läuterungskessel G
taucht; in seinen unteren Theil F'' werden kleine
Sägeschnitte gemacht, durch die das kohlensaure Gas in den Zuckersaft austritt. F' Rohr zur Vertheilung des Gases in die Kessel G und andere. H Stange, mit
einem Hahn d zum Abziehen des geläuterten Safts. I Rinne, aus welcher der Saft in das mit gekörnter
Knochenkohle gefüllte Gefäß K lauft. J hölzernes Gestell, auf welchem der Kessel G angebracht ist. L Rohr,
durch welches der Dampf unter den Kessel G gelangt. M Rohr, welches den Dampf in den Condensator führt. N oberer Kessel, welcher den mit Kalk vermischten Saft
enthält. O Stange mit einem Hahn, um diesen Saft in das
Filter P auslaufen zu lassen, welches Knochenkohle auf
einem Plüschgewebe enthält. Q Rohr, durch welches sich
der Saft in den Kessel G begibt.
a Hahn des Rohrs F. b Hahn
des Dampfrohrs L. c Hahn des Rohrs M. d Hahn am unteren Ende der Stange H. e Hahn zum Abziehen des filtrirten Safts.
Tafeln