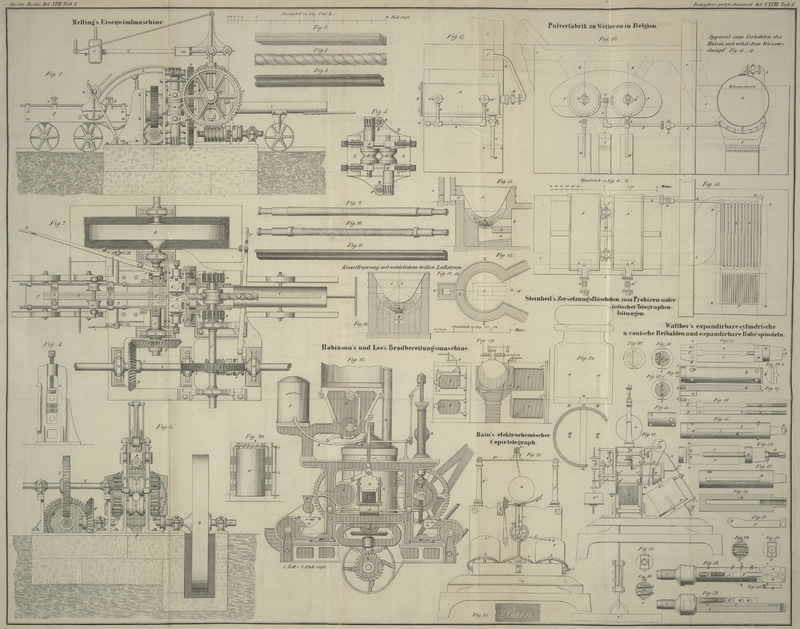| Titel: | Bain's patentirter elektro-chemischer Copirtelegraph. |
| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. VII., S. 40 |
| Download: | XML |
VII.
Bain's patentirter elektro-chemischer
Copirtelegraph.
Aus dem Mechanic's Magazine, 1850, Nr.
1383.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Bain's elektro-chemischer Copirtelegraph.
Fig. 21 stellt
meinen verbesserten Copirtelegraphen im Frontaufrisse, Fig. 22 in der
Seitenansicht dar. A ist eine Walze, auf welche mit
Hülfe der Aufziehachse W eine Schnur gewunden wird.
Diese Schnur trägt ein Gewicht W2, wodurch das Räderwerk in Bewegung gefetzt wird.
An dem einen Ende der Walze A befindet sich ein Zahnrad
a2, welches in ein
an der Achse des Rades B3 befindliches Getriebe greift. Das Rad B3 greift in ein an der Achse des Rades C3 befindliches
Getriebe c2. Das Rad
C3 steht mit einem
Getriebe d2 im
Eingriff, dessen Achse ein Winkelrad d3 enthält. E ist eine
in geeigneten Lagern sich drehende Verticalwelle, die an ihrem unteren Ende ein
Winkelrad e enthält, welches in das Winkelrad d3 greift, an ihrem
oberen Ende aber einen hervorragenden gebogenen Arm E2 trägt. Die Säulen F2, F2 tragen eine Querschiene F3 mit einem Träger f, von dessen Mitte, gegen den krummen Arm E2 anschlagend eine
Stange mit einem rotirenden Pendel P an einer Schnur der
Kette hängt. Durch Umdrehung der Schraube g2, deren unteres Ende den Aufhängungspunkt bildet,
kann das Pendel P gehoben oder niedergelassen und die
Geschwindigkeit des Instrumentes nach Belieben controlirt werden. Die Achse des
dritten Rades c3 ist
durch die Vorderplatte des Instrumentes verlängert und in einem Träger G gelagert, innerhalb dessen sie ein Winkelrad H enthält, welches in ein kleines an dem oberen Ende
einer geneigten Spindel befindliches Rad h2 greift. An dem unteren Ende enthält diese Spindel ein
großes Zahnrad I, welches zu beiden Seiten in die
ähnlichen Zahnräder K und L
greift. An jedem der Räder K, L befindet sich ein nach Belieben beweglicher Metallcylinder k2,l2 Die Achse des Rades
B3 welche
gleichfalls durch die Vorderplatte des Instrumentes hervorragt, enthält eine kleine
Rolle b4 von welcher
ein Band um die Rolle b5 läuft.
Die hohle Achse der letzteren dreht sich um einen Zapfen, welcher in dem Lager m eines verschiebbaren Trägers m2 liegt. An dem entgegengesetzten Ende
dieser hohlen Achse befindet sich eine kleinere Rolle b6 die sich vermittelst eines
Sperrkegels und Sperrrades mit der Achse nach einerlei Richtung dreht. An die Rolle
b6 ist das eine
Ende einer seidenen Schnur befestigt und aufgewickelt, während das andere Ende der
Schnur an das obere Ende einer Stahlstange M befestigt
ist. Letztere gleitet mit ihrem oberen Ende frei durch das Loch einer an den Träger
d4 befestigten
Elfenbeinplatte, mit ihrem unteren Ende durch eine Oeffnung in dem metallenen Träger
d5. Die
Stahlstange M trägt einen mit Hülfe der Stellschraube
n adjustirbaren hervorragenden Arm N, der an seinem äußersten Ende mit einer Stellschraube
p zur Aufnahme eines feinen Drahtes oder einer Nadel
versehen ist. Die Stange N läßt sich dergestalt wenden,
daß sie die erwähnte Nadel je nach Erforderniß mit dem einen oder dem andern der
Cylinder k2, l2 in Berührung
bringt. N2 ist eine
Messingsäule mit einem Loch und einer Stellschraube zur Aufnahme eines
Leitungsdrahtes. Diese Säule steht mit dem Träger d, der
Stange M und dem Arm N, p in metallischem Contact, sonst jedoch mit keinem
andern Theil des Apparates. N3 ist eine ähnliche Messingsäule, welche mit den
Rädern K und L und mit den
Cylindern k2, l2 directer
metallischer Verbindung steht. Ein elektrischer Strom kann daher nur von N2 nach N3 gelangen, indem er
aufwärts durch die Stange M, dann längs der Stange N und durch die Nadel nach einem der Cylinder k2, l2 seinen Weg nimmt.
Jeder zwischen die Nadel des Arms N und die Cylinder
gelegte Nichtleiter schneidet daher die Communication ab und verhindert den
Durchgang der Elektricität. Durch diese Unterbrechung des elektrischen Stroms wird
der Apparat in den Stand gesetzt, jedes Wort oder jede Figur zu copiren. Die dem
Räderwerk durch das Gewicht W2 ertheilte Bewegung wird durch das rotirende
Pendel P controlirt und gleichförmig gemacht; um jedoch
eine bei correspondirenden Instrumenten so nothwendige gleichzeitige Bewegung zu
erlangen, ist eine in Fig. 22 dargestellte neue
Art Hemmung eingeführt. Die Achse des Winkelrades d3
enthält nämtich an der
hinteren Seite des Gestells einen Arm S, an dessen eines
Ende eine krumme Stahlfeder s befestigt ist. Das innere
Ende der Feder ist mittelst eines kurzen Fadens mit einer unabhängigen Achse T verbunden. Diese enthält ein schneckenförmiges Rad t, welches zwischen zwei um eine Achse V oscillirenden Lappen (pallets) rotirt und abwechselnd mit ihnen in Eingriff kommt; letztere sind
durch eine Krücke v mit einem verticalen Pendel P2 verbunden. Die
Länge dieses Pendels wird durch eine obere und eine untere Schraube regulirt, so
daß, wenn das rotirende Pendel das Bestreben äußert, von seinem normalen Gang
abzuweichen, diesem Bestreben sogleich durch die Hemmung Einhalt gethan wird. Auf
diese Weise wird eine vollkommen gleichzeitige Bewegung erzielt, und die Anwendung
der Elektromagnete als Regulatoren entbehrlich.
Das beschriebene Instrument dient zum Absenden und zum Empfang der Depeschen. Die zu
gebende Nachricht wird mit Harzfirniß oder einem andern nichtleitenden Stoffe auf
Zinnfolie oder ein mit unächtem Blattgold überzogenes Papier geschrieben; oder was
noch besser ist, die Nachricht wird durch Hinwegkratzen des Metalls von der
Oberfläche verzeichnet. Letzteres kann leicht geschehen, indem man die Rückseite des
Papiers anfeuchtet, und dann mit einer stumpfen Spitze auf die metallische
Oberfläche schreibt. Die solchergestalt vorbereitete Mittheilung kommt auf einen der
Cylinder k2, l2, während ein
Cylinder des correspondirenden Instrumentes auf der andern Station mit chemisch
präparirtem Papier überzogen wird. Der durch eine Batterie an der transmittirenden
Station erzeugte galvanische Strom gelangt durch das Instrument und mittelst eines
einzigen Drahtes nach dem correspondirenden Instrumente der die Nachricht
empfangenden Stationen, und kehrt durch das Erdreich in die Batterie zurück. Da die
Cylinder k2, l2 rotiren, so sinkt
der Arm N, p, in Folge der
Abwicklung der Schnur von der Rolle b6, allmählich herab, wobei die Nadel auf dem
Cylinder von oben bis unten eine zusammenhängende Spirallinie beschreibt. Diese
Linie gestaltet sich auf dem chemisch präparirten Papier der andern Station als ein
permanenter Zug, welcher in gewissen Intervallen unterbrochen ist, die den mit dem
nichtleitenden Stoff auf dem metallisirten Papier gemachten Zeichen entsprechen.
Dieses wird durch Fig. 23 deutlich werden, welche eine durch den unterbrochenen
galvanischen Strom hervorgebrachte Copie des Namens Bain vorstellt.
Man kann auch das umgekehrte Verfahren anwenden, indem man mit einem leitenden
Material auf eine nicht leitende Oberfläche schreibt; die Zeichen der Depesche
bilden alsdann Punkte und Linien auf einem ebenen Grunde. Wenn die zu copirende
Oberfläche aus beweglichen Theilen, z. B. aus Lettern besteht, so bedient man sich
ebener Flächen anstatt der Cylinder.
Tafeln