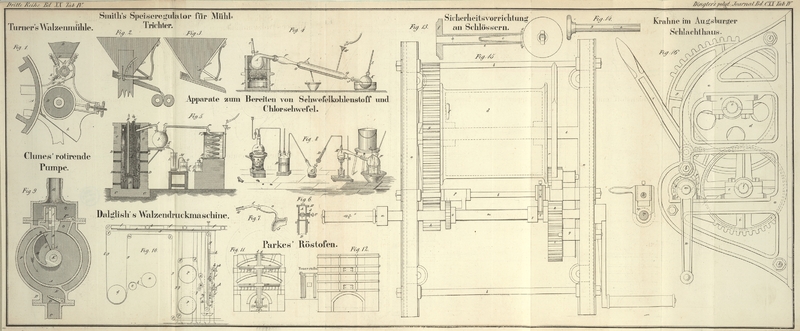| Titel: | Das neue Schlachthaus in Augsburg. |
| Fundstelle: | Band 120, Jahrgang 1851, Nr. XXXVIII., S. 183 |
| Download: | XML |
XXXVIII.
Das neue Schlachthaus in Augsburg.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Das neue Schlachthaus in Augsburg.
Für die schon in den Jahren 1609 und 1634 erbaute sehr geräumige und zweckmäßige
Augsburger Fleischverkaufshalle mit 126 Bänken, fehlte es an einem den
salubritäts- und sanitätspolizeilichen Anforderungen der Jetztzeit
entsprechenden Schlachthause.
Im Jahre 1850 ließ der Stadtmagistrat nach Erwerbung eines geeigneten Bauplatzes in
die unmittelbare Nähe der Fleischhalle an einem wasserreichen Lechcanale, mit einem
Aufwande von fast 20,000 fl. nach dem Plane und unter der Leitung des städtischen
Bauraths Hrn. F. J. Kollmann ein allen praktischen
Anforderungen entsprechendes Schlachthaus erbauen und analog den
sanitätspolizeilichen Vorschriften für die Gemeindeschlachthäuser in FrankreichMitgetheilt im polytechn. Journal Bd. CXVI S. 80. einrichten;
dasselbe wurde am 30. Decbr. v. J. miethweise der Metzgerinnung, welche jährlich bei
5000 Rinder und 20,000 Stück Jungvieh schlachtet, zum Gebrauche übergeben.
Dieser Schlachthausneubau steht von allen vier Seiten frei, stößt auf westlicher
Seite an die öffentliche Straße, auf nördlicher und südlicher Seite an geräumige
Privathöfe und mit der östlichen Seite an den mittlern Lechcanal. Die Länge beträgt
100 Fuß (bayer. Maaß) und die Breite 50 Fuß. Der Oberbau vom Niveau der Straße bis
zum Dachgesimse mißt 30 Fuß Höhe. Die Mauerwerke sind 8–10 Fuß tief unter der
Bodenfläche und 2 Fuß im Grundwasser fundirt und angelegt, und bestehen theils aus
großen Tuffsteinquadern, theils aus guten Backsteinen.
Die Umfangswände sind 2½ Fuß stark, wornach für den inneren nutzbaren Raum des
Hauses volle 95 Fuß Länge und 45 Fuß Breite bleiben. Das ganze Bauwerk ist, mit
einigen zeitgemäßen Modificationen im deutschen Rundbogenstyl, als sogenannter
Rohbau ausgeführt; es hat drei Haupteingänge, wovon der mittlere eine Lichtweite von
8 Fuß und eine Höhe von 13¾ Fuß, die beiden Seitenthore jedes 6 Fuß Breite
und 12 Fuß in der Höhe hält.
Der 4184 Quadratfuß haltende Fußboden besteht aus vierzölligen 20 Quadratfuß großen
Sandsteinplatten der härtesten Gattung, aus den Steinbrüchen von Rettenberg im
Allgäu. Das Pflaster hat fünf Neigungen, vier nach der Quere und eine nach der Länge
vom Eingang gegen den Canal, d. h. von vorn nach rückwärts mit einem Gefäll von 10
Zoll; es ist mit zwei offenen muldenförmig profilirten steinernen Ablaufrinnen, je 8
Fuß von den Seitenwänden abstehend, versehen, welche das Blut und alle
Unreinigkeiten der Schlachtung aufnehmen, und vereinigt in den östlich
vorbeifließenden Lechcanal mittelst einer senkrechten in das Wasser eintauchenden
Röhre abführen.
Zwei gußeiserne gefällig geformte und verschlossene Wasserreservoirs, an den
Wandpfeilern zwischen den Eingangsthoren angebracht, werden stündlich mit 8 Eimer
Wasser gespeist und liefern den erwähnten Ablaufrinnen zum Fortschaffen des Blutes
und Unrathes und zum anderweitigen Schlachtgebrauche fortwährend das nöthige
Brunnenwasser.
Außer diesen zwei Wasserreserven und dem laufenden Röhrwasser, dient, zur Vorsorge
bei eintretenden Unterbrechungen im Röhrwasserzuflusse bei Brunnenablässen, ein im
Treppenhause errichteter hinlänglich tiefer Pumpbrunnen mit mechanischem Druckwerke,
noch zu Reinlichkeitszwecken. Das Wasser dieses Brunnens kann mittelst des
Druckwerkes in Gefäße, oder mittelst Schläuchen an jede beliebige Stelle des
Schlachtraumes gepumpt werden, was die Reinigung des Bodens und der senkrechten
Wände befördert und beschlcunigt.
Wegen Raumgewinnung für die Schlachtung ist für die Auszugmaschinen (Krahne) in einer
Höhe von 15 Fuß über dem Fußboden, auf 24 zierlichen freien Trägern und Tragbalken
an drei Seiten des innern Baues eine aus Holz construirte Gallerie mit Geländer
erbaut, zu welcher eine verborgene, den Beschäftigten leicht zugängliche Treppe
führt.
Die zwanzig Zugmaschinen, deren specielle Beschreibung unten folgt, sind in der
mechanischen Werkstätte des Hrn. Jos. Kirner in Augsburg
gefertigt und dienen insbesondere zum Aufziehen der großen Schlachtstücke und
einzelner Theile derselben.
Zum Anbinden des Schlachtviehes vor und während der Schlachtung, welche in der Regel
durch Knicken vorgenommen wird, ist im Steinpflaster eine geeignete Anzahl fester
eiserner Ringe angebracht. Für die Schlachtung von Kleinvieh sind vier Rechen
vorhanden, deren zwei links und rechts an den Umfangsmauern, und zwei frei über den
Abwässerrinnen längs denselben in gefällig geformten Eisenhängwerken schwebend,
hergestellt worden. Letztere sind theils an der Decke, theils an den Gallerieträgern
befestigt. Diese vier Schlachtrechen sind zusammen mit 373 eisernen Haken
versehen.
Zur Förderung der Reinlichkeit an den Wänden und zum Schutze derselben gegen die
Einwirkung der Nässe, sind die Backsteinmauern im Innern des Schlachtraumes am
Sockel ringsum mit 3 Fuß hohen 2½ Zoll dicken Solenhofer Steinplatten
verkleidet, und der 2½ Fuß hohe Zwischenraum über demselben bis an die
Schlachtrechen wurde mit starker rother Cementschichte und mit gleicher blutrother
Oelfarbe überzogen.
Der ganze innere zwei Stockwerke bildende Schlachtraum wird durch 21 große
Bogenfenster im obern und 13 kleinere dergleichen im untern Raume vollkommen mit
Tageslicht erhellt.
Auf zwei steinernen Treppen östlich gelangt man in ein kleines Souterrain und von da
auf eine 40 Fuß lange, 6 Fuß breite gedeckte Brücke, welche längs dem Gebäude über
dem Lechcanale zum Waschen und Mickern der Eingeweide zweckmäßig erbaut ist.
Gleichwie für die Haupt- und Gallerietreppe befindet sich im innern
Schlachthausraume unter der Gallerie ein geeigneter symmetrischer Einbau als
Requisitendepot.
Der Dachstuhl des Gebäudes ist 22 Fuß hoch und besteht aus Hängwerken mit 6
Bundgespärren, jedes mit zwei gekuppelten Hängsäulen und doppeltem Sprengwerke; dann
26 Lehrgespärren. Die Construction des Dachstuhls ist einfach und solid genug, um
außer seinem und dem Gewichte der Eindeckung, auch mehrfach die ganze Last von 20
Stück 15–18 Centner schwerer Rinder und 200 Stück Kälber zu tragen. Das
Hauptgebälk nebst den Hängsäulen, Streben und Spannriegeln besteht aus 10/12″
starken, das Gespärre und die Pfetten aus 8/8zölligem Fichtenholz.
Das Dach selbst ist mit ziegelplatten doppelt und dicht eingedeckt. Der Dachraum ist
für geeignete Benützung mit gehobelten und gefalzten 5/4zölligen Brettern belegt.
Die dahin führende Treppe wird durch eine mechanische Vorrichtung leicht bewegt und
schließt zugleich die Plafond-Oeffnung horizontal ab.
Zur innern Verzierung des Schlachtraumes ist alles Holzwerk mit lichtbrauner
Lasurfarbe bemalt, und Gallerie, Schürbalken, Durchzüge und Thore mit rothen Linien
auf passende Weise façettirt.
Als Akroterium der Vorderfaçade ist das plastische Standbild eines am alten
Schlachtgebäude angebracht gewesenen lebensgroßen Ochsen angewendet, und zur
Bekrönung des östlichen Giebels sind in gleicher Art die plastischen Standbilder von
zwei lebensgroßen Jungviehstücken, eines Widders und eines Kalbes, aufgestellt. Der
Steinverband wechselt mit gelblichen und rothen Ziegeln in horizontalen Bändern und
Bogenschnitten gefällig ab.
Beschreibung der im Augsburger Schlachthaus
aufgestellten Krahne.
Diese von Hrn. Otto Beylich construirten Krahne gehören
der Kategorie der unbeweglichen, an die Mauer befestigten an, sind ganz aus Eisen
hergestellt und mittelst zwei Paaren Stirnräder übersetzt. Für die Uebersetzung
ergibt sich aus nachstehenden Daten, nämlich: Länge der Kurbel = 14″, erstes
Räderpaar mit 11 und 44 Zähnen, zweites Räderpaar mit 11 und 55 Zähnen, Durchmesser
des Seilcylinders = 14″, das Verhältniß = 1 : 40.
Sonach erfordert die Last eines Rindes, im Mittel = 1000
Pfd. mit Hinzurechnung von 10 Proc. zur Ueberwindung der Reibungs- und
Seilsteifheits-Widerstände angenommen, 27,5 Pfd. Kraft, mittelst welcher bei einer Geschwindigkeit von 40 Umdrehungen jene
Last auf eine Höhe = 7′ 4″ gehoben wird.
Die Seile dieser Krahne sind von den Seilwalzen aus unter einem Winkel von circa 45° über an den Durchzügen der Decke
angebrachte Rollen
geführt, und hängen von da frei herab. Am Ende derselben befinden sich die mittelst
Haken waagrecht eingehängten Querhölzer, an welchen die Rinder auf allgemein
bekannte Weise befestigt werden.
Zu größerer Bequemlichkeit beim Herablassen der Lasten sind die Krahne mit
Bremsscheiben versehen, und haben daher auch Vorrichtungen zum seitlichen Ausrücken
der Treibachsen aus dem Eingriffe.
Fig. 15 und
16
veranschaulichen genau die Construction aller Einzelheiten.
a, a sind zwei Lagergestelle, welche durch drei Stangen
b, b, b miteinander verbunden und mittelst vier
Schraubenbolzen an der Mauer befestigt sind.
c, c, c sind Achsenlager.
d ist der hohlgegossene auf seiner Achse e aufgekeilte Seilcylinder, mit einem Haken f zur Aufnahme des Seilohres versehen.
g und h zeigen das zweite,
i und k das erste
Räderpaar. Das Rad g ist auf der Achse e, die Räder h und i sind auf l und das Rad k ist auf m mittelst Keilen
befestigt.
Die Achse m bildet die Triebachse und ist an beiden Enden
mit Kurbeln n, n versehen. Zur Verhütung rückgängiger
Bewegung ist auf dieser Achse auch das Sperrrädchen o
angebracht. Der einfallende Sperrkegel p dreht sich auf
der mittlern Verbindungsstange zwischen zwei Stellringen.
Die Bremsscheibe q befindet sich neben dem Rade i und ist mit diesem aus einem Stücke gegossen. r zeigt den Bremshebel, welcher auch seinen Stützpunkt
in der mittleren Verbindungsstange hat.
s ist ein Anpaß auf der Achse m, welcher mit der Nabe des Rädchens k die
Nuth t bildet, in welche der Schieber u eingelegt ist, wenn eine Last aufgezogen wird.
Soll aber beim Herablassen die Bremse benützt werden, so ist der Schieber u zu heben und die Achse m
von links nach rechts zu schieben, wodurch die Räder k
und i aus dem Eingriffe kommen und die Achse m isolirt wird. Der Schieber u legt sich jetzt links des Anpasses s ein,
und hält die Achse ausgerückt.
Tafeln