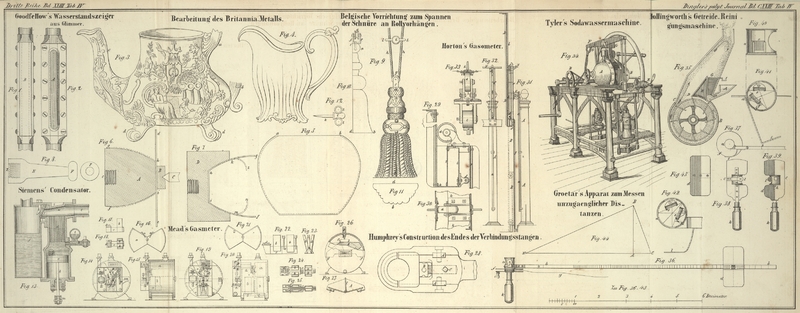| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, welche sich Charles Mead, Ingenieur zu Charlotte Cottages, Old Kentroad in der Grafschaft Surrey, am 21. Jan. 1851 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 123, Jahrgang 1852, Nr. XLVIII., S. 285 |
| Download: | XML |
XLVIII.
Verbesserungen an Gasmessern, welche sich
Charles Mead,
Ingenieur zu Charlotte Cottages, Old Kentroad in der Grafschaft Surrey, am 21. Jan. 1851 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Oct. 1851, S.
327.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Mead's Verbesserungen an Gasmessern.
Der erste Theil dieser Erfindung bezieht sich auf Verbesserungen an nassen
Gasmessern, wodurch das Messen mit einer Meßkammer
bewerkstelligt wird. Die zweite Verbesserung ist eine Modification der ersten, indem
zwei Meßkammern in Anwendung kommen. Bei Gasmessern dieser Construction hat die Höhe
oder die Quantität des Wassers keinen Einfluß auf das Messen des Gases. Die dritte
Verbesserung bezieht sich auf den Zählapparat. Die letzte Abtheilung der Erfindung
betrifft Verbesserungen an Apparaten zum Messen des Wassers oder anderer
Flüssigkeiten.
Fig. 14
stellt einen nach dem ersten Theil der Erfindung construirten Gasmesser mit
abgenommener Vorderplatte im Frontaufriß, Fig. 15 in der
Seitenansicht dar. Fig. 16 ist die Frontansicht der Gaskammer, Fig. 17 eine
Seitenansicht des Ventilsitzes und der Gasröhren; Fig. 18 ein Grundriß
derselben. a ist eine oscillirende metallene Kammer mit
zwei Abtheilungen, in welche die Gasröhren b, b
hineinragen. Die andern Enden dieser Röhren sind mit den horizontalen Röhren c, c verbunden und diese letzteren an den Ventilsitz d befestigt. In dem Ventilsitz befinden sich drei
Oeffnungen, wovon die mittlere mit dem Gascanal e und
die Seitenöffnungen mit den Röhren c und b in Verbindung stehen.
Das Gas tritt durch die Röhre f in den Gasmesser, nimmt
seinen Weg abwärts durch die Röhre e, und wird je nach
der Stellung des Ventils g in eine Abtheilung der
messenden Kammer a geleitet. Das Gas hebt sofort diese
Abtheilung und veranlaßt dadurch eine der Hervorragungen n auf die Rolle o zu wirken und dieselbe nebst
dem Hebel, woran sie befestigt ist, vorwärts zu schieben. Zugleich wirkt der eine
Arm des Hebels i auf das Ventil g und verändert seine Stellung. Dadurch wird das Gas von derjenigen Röhre,
welche es in die eine Kammer des Meßbehälters geleitet hatte, abgesperrt; dagegen
wird nun diejenige Röhre, welche das Gas von der andern Kammer hinweggeführt hatte, die zuführende
Röhre für diese Abtheilung. h, h sind belastete Hebel,
welche so adjustirt sind, daß sie den Kipphebel i
unterstützen, wenn derselbe in eine solche Lage gefallen ist, daß er das Ventil g in die geeignete Stellung gebracht hat. Diese
belasteten Hebel helfen außerdem vermöge ihres Bestrebens in die verticale Lage
zurückzukehren, dem Gasbehälter den Kipphebel aus denjenigen Stellungen zu heben,
welche zu seiner Bewegung die meiste Kraft erfordern.
Um die Quantität des durch den Meter gegangenen Gases zu registriren, ist eine Stange
j mit einem von dem oberen Theil des Gasbehälters
hervorragenden Metallstück und einem Hebel k verbunden,
welcher durch einen Draht l mit einem andern in der
Röhre m sich bewegenden Draht in Verbindung steht. Das
obere Ende dieser Röhre tritt in die Zeigerbüchse, das untere Ende aber unter das
Wasserniveau, um eine Gasentweichung in die Zeigerbüchse zu verhüten. Das obere Ende
des in der Röhre m spielenden Drahtes ist mit einem
kurzen Hebel verbunden und dieser enthält einen Sperrkegel, welcher in die Zähne
eines zu dem registrirenden Räderwerk gehörigen Sperrrades greift, so daß die
Bewegung der oscillirenden Kammer a bei dem jedesmaligen
Niedersteigen des Drahtes in die besagte Röhre dem Räderwerk einen Impuls
ertheilt.
Fig. 19
stellt einen Gasmesser mit zwei messenden Behältern, nach Hinwegnahme der
Vorderplatte im Frontaufriß, Fig. 20 in der
Seitenansicht dar. Fig. 21 zeigt einen der Gasbehälter in der Frontansicht; Fig. 22 den Ventilsitz
und die Gasröhren in der Seitenansicht, Fig. 23 in der
Endansicht, Fig.
24 im Grundriß, und Fig. 25 im Durchschnitt.
a, a sind die beiden oscillirenden Meßbehälter, von
denen jeder, wie oben, in zwei Kammern getheilt ist, in welche die Gasröhren b, b hineinragen. Die andern Enden dieser Röhren sind
mit den horizontalen Röhren c, c verbunden, durch welche
eine Communication mit dem Ventilsitz d hergestellt
wird. Der Ventilsitz ist mit sechs Oeffnungen versehen, von denen die beiden
mittleren mit den Gascanälen e und f, die andern mit den Röhren c,
c in Verbindung stehen. Das Gas tritt durch die Röhre f in den Meter, strömt die Röhre e hinab, und gelangt je nach der Lage der Ventile g, g in zwei von den Röhren c, von da in die
Röhren b, b und findet sofort seinen Weg in eine der
Kammern der messenden Behälter. Indem das Gas die Enden der letzteren hebt, setzt es
durch Vermittelung der Verbindungsstangen h, h die
Kurbel i
Fig. 20 und
ihre Achse j in Rotation. An dem vorderen Ende der Achse j befindet sich eine endlose Schraube k, welche an ihrer Vorderfläche mit einem kleinen
Kurbelzapfen versehen ist, der vermittelst der Verbindungsstangen l, l und der Hebel m, m mit
den Ventilen g, g communicirt. Dieser Kurbelzapfen ist
so angeordnet, daß er die Ventile verschiebt, sobald die Kammern der messenden
Behälter mit Gas gefüllt sind. Auf diese Weise wird eine bestimmte Quantität Gas
gemessen und ein gleichmäßiges Zuströmen nach den Brennern erzielt.
Um die Menge des durch den Meter gegangenen Gases zu registriren, greift die Schraube
k, Fig. 19, in das
Schraubenrad n, welches an einer durch die Stopfbüchse
o gehenden Spindel sitzt. Das andere Ende dieser
Spindel ist mit einer kleinen endlosen Schraube p
versehen, welche den Zählapparat in Bewegung setzt.
Der verbesserte Zählapparat besteht im Wesentlichen aus einer Reihe von Trommeln oder
Rädern, welche auf ihrer Peripherie mit Ziffern versehen und an einer
gemeinschaftlichen Achse angeordnet sind. Diese Räder bewegen sich nur, wenn die
Ziffern sich ändern sollen. An der ersten Trommel befindet sich nämlich ein
Schraubenrad q, welches durch eine endlose Schraube p getrieben wird. Diese Bewegung wird nun den Trommeln
mit Hülfe von Federhaken auf ähnliche Weise, wie bei dem gewöhnlichen Zählapparat
mitgetheilt. Die erste Trommel ist um ein Bedeutendes breiter als die übrigen, und
enthält zwei Reihen Ziffern auf ihrem Umfange. Die erste Reihe besteht aus zehn
Nullen und zehn Fünfern, welche abwechselnd rings um die Trommel vertheilt sind, die
zweite Reihe aus einem doppelten Zahlensystem von 0 bis 9 welche auf diese Weise
angeordnet sind: 1, 1; 2, 2; 3, 3; 4 u.s.w. Demnach werden am Anfang die durch beide
Reihen an den Oeffnungen der Zeigerplatte zum Vorschein kommenden Ziffern 0 0 seyn,
dann 05, hierauf 10, sodann 15 und so fort. Auf der zweiten und dritten Trommel ist
eine einfache Ziffernfolge von 0 bis 9 vertheilt. Jede Trommel, mit Ausnahme der
ersten, ist mit einem Sperrrad, und jede Trommel, mit Ausnahme der letzten, mit
einem Sperrkegel versehen.
Die Sperrkegel sind so angeordnet, daß sie, wenn die Trommeln, woran sie befestigt
sind, 9/10 einer Umdrehung gemacht haben, unter stationäre Federn treten, welche sie
mit ihren Sperrrädern in Eingriff bringen und dadurch die Trommeln, womit die
Sperrräder verbunden sind, veranlassen, 1/10 einer Umdrehung zu machen. Sobald ein
Sperrkegel, an der
stationären Feder vorübergegangen ist, wird er durch seine eigene Feder aus dem
Eingriff mit dem Sperrrad gehoben.
In Folge dieser Einrichtung treibt jede Trommel die nächstfolgende, und wenn die
Trommel zur rechten 10 Umdrehungen gemacht hat, so hat die zweite 1 und die dritte
1/10 einer Umdrehung gemacht.
Fig. 26
stellt einen Apparat zum Messen des Wassers oder anderer Flüssigkeiten im
Frontaufriß, Fig.
27 den messenden Behälter im Durchschnitte dar. Der oscillirende Behälter
A ist durch die Scheidewand C in zwei Abtheilungen getheilt und mit zwei an ihn befestigten Eimern g, g versehen. B ist ein
Recipient mit einer länglichen Oeffnung im Boden, um den aus der Zuflußröhre D hervorkommenden cylindrischen Strahl in einen flachen
zu verwandeln. E ist die Ausflußröhre. Die zu messende
Flüssigkeit wird durch die Röhre D in den Recipienten
B geleitet, von wo aus sie in die eine Abtheilung
des messenden Behälters fällt, bis sich eine solche Quantität darin gesammelt hat,
daß sie umschlägt.
Die relativen Stellungen der beiden Enden ändern sich nun, das Wasser fließt aus, und
die andere Abtheilung des Meßbehälters kommt in eine solche Lage, daß sie die
Flüssigkeit aufnimmt. Letztere wird durch die Scheidewand C in die eine oder die andere der beiden Abtheilungen geleitet, indem
diese Scheidewand mit dem ganzen Behälter in eine solche Lage fällt, daß sie die
Flüssigkeit immer in die höher gelegene Abtheilung leitet. Die Quantität der bei
jeder Oscillation des Meßbehälters ausgeleerten Flüssigkeit wird durch kleine
Aufhälter f, f, welche den Oscillationswinkel bestimmen,
regulirt. Damit das Umschlagen des Behälters mit größerer Sicherheit von statten
gehe, sind zwei kleine Eimer g, g so an ihn befestigt,
daß die letzte Portion der in die Abtheilung geleiteten Flüssigkeit, bevor das
Umschlagen erfolgt, in einen solchen Eimer fließt, wodurch die mechanische Wirkung
auf den Behälter erhöht wird. Um die Quantität der durch den Apparat gegangenen
Flüssigkeit zu registriren, wird bei jeder Oscillation des Behälters ein Zeiger in
Thätigkeit gesetzt.
Tafeln