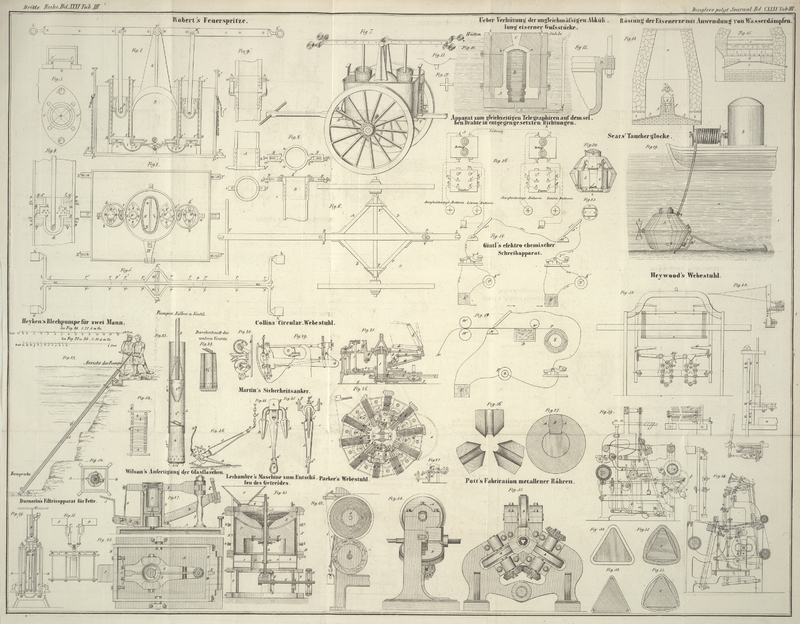| Titel: | Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von Wasserdämpfen. |
| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. LIV., S. 212 |
| Download: | XML |
LIV.
Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von
Wasserdämpfen.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Ueber die Röstung der Eisenerze mit Anwendung von
Wasserdämpfen.
Eine sehr wesentliche Verbesserung beim Rösten der Eisenerze besteht in der Anwendung
von Wasserdämpfen. Es ist bekannt, welchen vortheilhaften Einfluß die bis zu einer
gewissen Menge angewendeten Wasserdämpfe auf den Hohofenproceß ausüben, indem sie
den Schwefelgehalt des Roheisens beträchtlich vermindern. Eine ähnliche Wirkung
haben die Wasserdämpfe, wenn man sich ihrer bei der Röstung schwefelkieshaltiger
oder mit anderen Schwefelmetallen verunreinigter Erze bedient. Im Jahr 1843 wurden
in Russisch-Finnland auf dem Eisenwerke Dals-Bruck, nach dem
Vorschlage v. Nordenskjöld's (Oberintendanten des
finnländischen Bergwesens), mehrere Versuche ausgeführt, schwefelkieshaltige
Magneteisensteine mit Beihülfe von Wasserdämpfen zu rösten. Die Röstung geschah in
gewöhnlichen, daselbst gebräuchlichen Rumford'schen Oefen
(mit Flammenfeuerung). Bei dieser Röstung wurde der beigemengte Schwefelkies
vollkommen zersetzt, und nach Verschmelzung der Erze im Hohofen und Verfrischung des
erhaltenen Roheisens erhielt man ein vortreffliches Stabeisen, welches nicht eine
Spur Rothbruch zeigte. Seit dieser Zeit bedient man sich sowohl in Finnland wie auch
am Ural des Dampfröstens der Eisenerze und wendet dabei zur Feuerung entweder Holz
oder Hohofengase an. Im Jahr 1845 verbesserte v. Nordenskjöld die Construction der Röstöfen, indem er denselben eine ganz
ähnliche Einrichtung gab, wie die schwedischen und norwegischen Flammröstöfen
besitzen.
Fig. 14 und
15 auf
Tab. III zeigen einen solchen Röstofen in zwei Verticaldurchschnitten, die auf
einander senkrecht stehen. In Fig. 15 ist nur der
untere Theil des Ofens dargestellt. a der Schachtraum,
welcher mit Eisenerzstücken ausgefüllt wird. Der obere Theil desselben ist, wie aus
der Figur erhellt, abgestumpft conisch, und der untere hat eine cylindrische
Gestalt. Die Schachtwände bestehen aus hinreichend feuerfesten Bruchsteinen. d der in horizontaler Richtung durch den Ofen laufende
Feuerungsraum. Den Boden desselben bildet der Rost, auf welchen das Brennmaterial
(Holz) gelegt wird, und durch dessen Zwischenräume die Asche in den Aschenfall e fällt. Als Bedachung des Feuerungsraumes dienen
mehrere dicht an einander gelegte massive Gußeisenstücke c, wegen ihrer (nach oben in eine Kante auslaufenden) Gestalt
„Schweinerücken“ (Griseryg)
genannt. Diese Gußeisenstücke ruhen aber nicht unmittelbar auf den gemauerten
Seitenwänden des Feuerungsraumes, sondern auf kleineren Eisenstücken, die, wie die
Figur zeigt, Zwischenräume lassen, durch welche die Flamme des Brennmaterials in den
Schachtraum gelangt. b, b zwei einander gegenüber
liegende Oeffnungen, aus denen das gut geröstete Erz, indem man es auf den schief
liegenden eisernen Platten g, g mittelst einfacher
Geräthschaften leicht zum Gleiten bringt, aus dem Ofen gezogen wird. Das auf solche
Weise entfernte geröstete Erz wird durch ungeröstetes ersetzt, welches man oben in
den Schachtraum füllt. Der Aschenfall ist mit zwei einander gegenüberliegenden
Zugöffnungen o, o versehen, die sowohl zum Eintritt der
zum Verbrennen des Brennmaterials nöthigen Luft, als zum Ausziehen der zu sehr
angehäuften Asche dienen. Der Feuerungsraum steht mit einer Schüröffnung p in Verbindung, die mit einer eisernen Thüre versehen
ist. Zuweilen sind zwei einander gegenüberliegende Schüröffnungen vorhanden. Zum
Rösten mit Wasserdampf läuft nun auf dem Schweinerücken c ein eisernes Dampfrohr r hin, welches an
zwei einander gegenüberliegenden Seiten mit je acht kleinen Oeffnungen versehen ist,
durch welche der in einem Dampfkessel erzeugte und von da in das Rohr r geleitete Dampf in den Ofen tritt, und sich hier mit
dem aufwärtssteigenden Strome der Ofengase mengt. Das Dampfrohr r wird durch das darüber angebrachte spitze gußeiserne
Dach s geschützt. Die ganze Feuerungsvorrichtung, deren
dossirte Seitenwände noch mit den eisernen Platten f, f
versehen sind, hat eine Gestalt, welche das Ausziehen des gerösteten Erzes sehr
begünstigt und das Mauerwerk vor Beschädigungen schützt.
Um die günstigste Wirkung der Wasserdämpfe auf das in der Röstung befindliche
Eisenerz zu erreichen, ist ein gleichzeitiger Luftzutritt durchaus erforderlich.
Schwefeleisen und Wasserdämpfe zerlegen einander zu Eisenoxydul und
Schwefelwasserstoff. Würde letzteres in den oberen Theil des Schmelzofens gelangen,
so würde es hier jedenfalls theilweise zerlegt werden und eine neue Portion
Schwefeleisen bilden, was die möglichst vollständige Entschwefelung des Erzes nichts
weniger als begünstigen könnte. Findet dagegen ein hinreichender Luftzutritt statt,
so verbrennt der gebildete Schwefelwasserstoff sogleich zu schwefliger Säure, welche
bei ihrem Aufsteigen durch das Erz von keinem schädlichen Einfluß ist.
Bei einer Vergleichung der verschiedenen Röstmethoden hinsichtlich ihrer nützlichen
Leistungen hat man sowohl auf den dabei stattfindenden
Brennmaterialverbrauch, als auf den erreichten Grad der Oxydation Rücksicht zu nehmen. In Bezug auf
Brennmaterialverbrauch ist die Röstung in freien Haufen die am wenigsten
vortheilhafte; etwas günstiger stellt sich das Verhältniß bei der Stadelröstung, am
günstigsten aber bei der Ofenröstung. Nach af Uhr verhält
sich das zur Haufenröstung nöthige Quantum des Brennmaterials zu dem bei der
Ofenröstung erforderlichen, unter sonst gleichen Umständen, etwa wie 17: 11. Bei den
Flammröstöfen dürfte verhältnißmäßig etwas mehr Brennmaterial verbraucht werden, als
bei den Oefen, in welchen Brennmaterial und Erz mit einander gemengt (geschichtet)
angewendet werden. In Betreff des zweiten Punktes aber, nämlich der zur Zerlegung
der Schwefelmetalle unerläßlichen oxydirenden Wirkung des
Röstprocesses, ergeben sich die letztgenannten Oefen offenbar als die
mangelhaftesten Vorrichtungen, welche selbst den freien Haufen und Stadeln
nachstehen; denn der in diesen Oefen aufsteigende heiße Gasstrom wird eher von
reducirender, als von oxydirender Wirkung seyn. Folglich stellen sich als die im Ganzen vortheilhaftesten Vorrichtungen zur Röstung der
Eisenerze die Flammröstöfen, und unter diesen wieder die
mit Anwendung von Wasserdämpfen betriebenen, heraus. (Scheerer's Metallurgie, Bd. I S. 75, und Bd. II S.
77.)
Tafeln