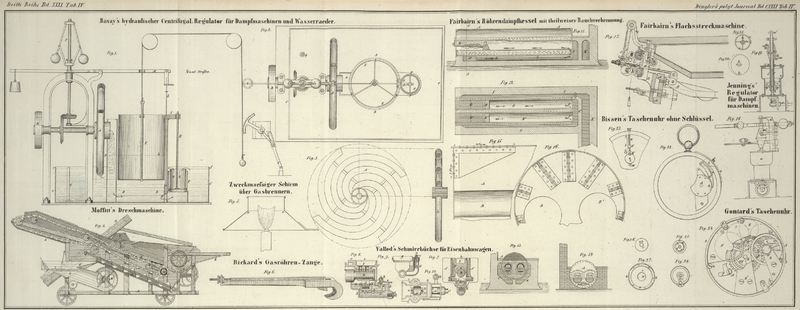| Titel: | Taschenuhr, welche vierzehn Tage geht, von Hrn. Gontard zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 131, Jahrgang 1854, Nr. LXVII., S. 259 |
| Download: | XML |
LXVII.
Taschenuhr, welche vierzehn Tage geht, von Hrn.
Gontard zu
Paris.
Aus Armengaud's Génie industriel, Nov. 1853, S.
266.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Gontard's Taschenuhr.
Diese Taschenuhr, welche in Fig. 24 bis 28 dargestellt
ist, unterscheidet sich von den gewöhnlichen hauptsächlich durch die Anordnung ihres
Federhauses.
B stellt ein gewöhnliches Gehäuse vor; es ist an seinem
äußern Umkreise mit einem kleinen Rande versehen und im Innern so hoch wie die ganze
Uhr. Eine zweite Vertiefung T, Fig. 27, folgt auf die
erstere; ihr Radius, welcher kürzer ist, läßt den Theil Z von dem Boden der ersten Vertiefung sehen. Die Vertiefung T ist diejenige des Federhauses und ebenso tief als die
erstere.
Eine Platine A, Fig. 24, auf welcher die
Brücken angebracht sind, welche die Räder an ihrem Platz erhalten, tritt frei in das
Gehäuse B, ruht auf dem Theile Z und ist mittelst der Schrauben a, b, c
darauf befestigt. Diese Platine dient auch als Deckel für das Federhaus.
Fig. 24
stellt die zusammengesetzte Uhr dar. B' ist die Brücke
des Federhausstiftes; S diejenige welche einen Theil des
Räderwerks hält; C die des Cylinderrades oder der
Unruhe; D der Hahn, auf seinem Schlitten E, welcher auf der Platine mittelst zweier Schrauben
befestigt ist, von denen sich eine unter dem Hahn befindet.
Der Federhausstift ist mit einem Sperrrade R versehen,
von dem nur ein Drittel der Dicke verzahnt ist, während zwei Drittel unten einen
kreisförmigen Vorsprung bilden, der einen etwas kleineren Durchmesser hat als das
Sperrrad (von dem Boden der Zähne ausgehend).
Das Rad H ist auf dem Vorsprung des Sperrrades
angebracht. Der Kern des Federhausstiftes, welcher einen viel größeren Durchmesser
hat als der Vorsprung, auf dem er durch zwei starke Schrauben und durch zwei Füße
befestigt ist, hält auch das Rad H, welches auf dem
Stift nur aufgeschoben ist. Dieser Kern ist da, wo er mit dem Boden des Federhauses eine Fläche bildet,
hohl, damit X ohne Berührung eintreten kann, während der
Rand des Kernes oder der Ring den Boden des Federhauses fast berührt; dieser Ring
trägt den Haken, an welchen das innere Auge der Feder befestigt wird.
Das Rad H ist in der Nähe von h mit einem Sperrkegel mit Feder V versehen;
um diesem Sperrkegel die ganze nöthige Kraft zu geben und folglich Unfälle in Folge
eines Zerspringens der Feder zu vermeiden, brachte der Erfinder einen Stift an, der
so stark ist, daß er der Feder widerstehen kann; auf das Rad, außerhalb der
Vertiefung, hat er eine Schraube aufgesetzt, deren breiter Kopf zum Theil auf dem
Sperrkegel ruht, und die Vertiefung auf dem Rade wurde erweitert, um den
Schraubenkopf aufzunehmen. Die Schraube hält den Sperrkegel an seinem Platz und
gestattet ihm eine freie Wirkung, ohne daß er in Unordnung kommen kann.
Das zweite Rad M hat 84 Zähne und bewegt einerseits das
Räderwerk und andererseits den Minutenzeiger. Ein Rad G,
Fig. 25,
mit 28 Zähnen, zuvörderst bis in deren Nähe vertieft und dann in der Mitte mit einem
Loch versehen, welches fast eben so groß als die Vertiefung oder Versenkung ist,
sitzt mit geringer Reibung auf dem Rade L; ein Stahlrad
R, ohne Zähne, auf der Röhre des Getriebes L angebracht, tritt in die Versenkung des Rades von 28
Zähnen, und sein Mittelpunkt ruht auf L, wo er mit zwei
Schrauben befestigt ist.
Der erste äußere Kreis ist das Rad L, der zweite das Rad
G von 28 Zähnen; der dritte, das Stahlrad R, tritt in die Versenkung des Rades G, und in der Mitte befindet sich die Röhre des
Getriebes von dem Rade L, welche etwas über das Ganze
vorsteht.
Fig. 26
stellt das Rad L von oben mit seinem Getriebe und den
beiden Schrauben dar, welche das Stahlrad halten. Diese Anordnung gewährt eine sehr
gute Reibung und den Vortheil, sich ohne alle Unbequemlichkeit wiederherstellen zu
lassen; ohne dieselbe oder eine ähnliche könnte man die Zeiger nicht auf die Minute
und die Stunde stellen.
Die Brücke B' hat rings um das Loch, in welchem sich der
Stift der Feder dreht, eine Versenkung K, welche zur
Aufnahme des Röhrenrades von dem Minutenzeiger dient, und links eine andere, tiefere
Versenkung Y. Eine Spindel im Mittelpunkt von Y nimmt die Röhre des Getriebes von L auf; alsdann bewegt das Rad M von 84 Zähnen dasjenige von 28 Zähnen und das Rad L, welches den Zapfen des Minutenzeigers bewegt und durch sein Getriebe
die Röhre des Stundenzeigers.
Die Spindel oder der Zapfen des Federhauses ist seiner ganzen Länge nach durchbohrt
und nimmt eine Spindel auf, die sich frei in der Röhre bewegt; diese Spindel nimmt
mit starker Reibung den Minutenzeigerzapfen zur Seite der Brücke B' auf, während sie an der entgegengesetzten Seite einen
kleinen quadratischen Angriff hat, welcher in eine Pfanne eintritt, die in dem
Quadrat des Aufzuges befindlich ist. Diese Pfanne ist groß genug, daß das Quadrat
eines kleinen Schlüssels eintreten und die Zeiger drehen kann.
Links von der Brücke B' sieht man einen stählernen Riegel
F, der durch eine Schraube gehalten wird; dieses
Stück dient, indem man seinen längern Theil in einen der Zähne des Rades H treten läßt, um die Wirkung der Feder ganz aufzuheben,
so daß man die ganze Uhr auseinander nehmen kann, ohne die Feder aufrollen zu
lassen. Die beiden Stahlstücke d und e sind die Gehäuseschlüssel.
Damit sich das Oel der Feder nicht mit demjenigen des Räderwerks vermischen kann,
bringt der Erfinder zwischen die Platine und die Feder eine Messingplatte, vom
Durchmesser der Platine; diese Platte ist, wie die Platine, in der Mitte mit einem
Loch versehen, um den Zapfen des Federhauses durchzulassen, und am Rande mit fünf
Löchern, welche denen des Theiles Z, Fig. 27, entsprechen.
Wenn die Schrauben a, b, c angezogen sind, so halten sie
die Platte und die Platine fest.
Die Stellung oder Correction ist außerhalb des Gehäuses B, Fig.
24, befestigt, unter dem Ring des Glases. Man sieht, daß sie aus einem
dünnen Stahlblatte, im Innern des Gehäuses, und aus einem außerhalb befindlichen
Zeiger besteht, welche auf dem Gehäuse verzeichneten Graden entsprechen.
Wenn man in der Nähe des Randes von dem Schlitten eine Spindel anbrächte, welche auf
der Seite des Gangwerks eine Gabel trägt, die ihrerseits die Stellung bewegt, und
auf der Seite des Bodens von dem Federhause einen Zeiger auf einem quadratischen
Zapfen, so könnte man beim Richten der Uhr das Oeffnen des Glases vermeiden. Auch
kann man auf der Röhre des Sperrrades einen Zeiger anbringen, welcher die
Abwickelung der Feder anzeigt.
Auf den ersten Blick scheint es, als wenn das Räderwerk dieser Uhr, welches am
Umfange der Platine liegen muß, nicht den gehörigen Platz hätte; geht man aber in
eine nähere Untersuchung ein, so sieht man, daß die Durchmesser der beweglichen
Theile nicht verändert sind. Was nun die Zwischenräume betrifft, welche sie zwischen
sich haben müssen, so können sie ganz dieselben wie bei allen gut eingerichteten
Uhren seyn; für die Hemmung, die Unruhe, das Cylinderrad und das Kronrad sind die
Zwischenräume
besser, weil das Mittelrad über der Unruhe hier nicht vorhanden ist und daher von
einer gegebenen Höhe nicht so viel beansprucht wird.
Die Anzahl der Zähne der verschiedenen Räder ist folgende: das erste Rad H hat 80 Zähne, sein Getriebe 10; das zweite M, 84 Zähne, das Getriebe 10; das dritte N, 64 Zähne, das Getriebe 10; das vierte O, 60 Zähne, das Getriebe 8; das fünfte P, 60 Zähne, das Getriebe 8; und das sechste, das
Cylinderrad, hat 16 Zähne und sein Getriebe 6.
Für das Zeigerwerk hat man: das von M bewegte Rad 36
Zähne, sein Getriebe 10; das Röhrenrad 40, und das Minutenrad 12.
Tafeln