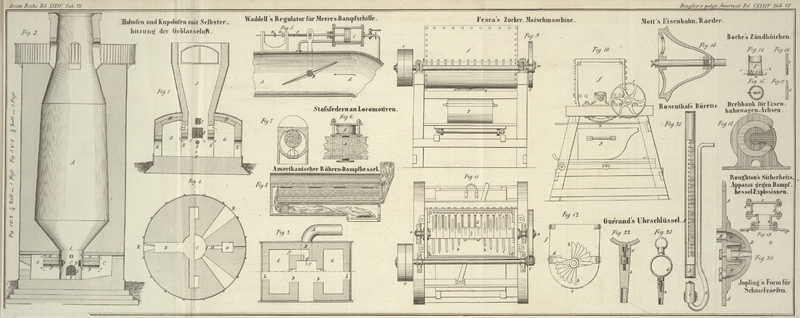| Titel: | Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der Gebläseluft; von den HHrn. Wright und Brown, Eisenschmelzer zu Newcastle am Tyne. |
| Fundstelle: | Band 134, Jahrgang 1854, Nr. CXXIV., S. 421 |
| Download: | XML |
CXXIV.
Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der
Gebläseluft; von den HHrn. Wright und Brown, Eisenschmelzer zu Newcastle am Tyne.
Aus dem Practical Mechanic's Journal, Octbr. 1854, S.
146.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Wright's Hohofen und Kupolofen mit Selbsterhitzung der
Gebläseluft.
Diese wichtige Abänderung der mit erhitzter Gebläseluft betriebenen Hohöfen
verspricht große Ersparungen oder Haushaltsvortheile bei der Eisenfabrication. Sie
ist nicht allein beim Hohofenproceß zum Verschmelzen der Erze, sondern auch beim
Umschmelzen des Roheisens in Kupolöfen zum Gießereibetriebe anwendbar. Statt den
Wind unmittelbar, entweder kalt oder nach vorheriger Erhitzung in einem besondern
Apparat, in den Ofen zu blasen, ist der Ofen oder Schmelzraum so eingerichtet, daß
er als Heizer seines eigenen Gebläsewindes wirkt. Zu dem Ende enthält der untere
Theil des Ofens Räume zur Aufnahme einer Masse von geschmolzenem Metall, die aus den
obern Theilen niedergegangen ist und als Heizoberfläche für die von außen
einströmende kalte Gebläseluft wirkt. Es wird daher letztere zuerst in diese Kammern
eingeblasen und dringt, sobald sie hier erwärmt worden ist, aufwärts, um mit der
Masse der Schmelzmaterialien, welche behandelt werden sollen, in Berührung zu treten.
Auf die Construction der Hohöfen angewendet, wird die kalte Luft zuvörderst in den
untern Theil des Ofens eingeführt und gelangt alsdann in Heizkammern, welche in der
Sohle und an den Seiten des Ofengemäuers angebracht sind. Hernach wird sie in den
Ofen eingeblasen, und zwar in einer Ebene, die etwas über derjenigen der Form liegt,
wo sie die Kohks und Beschickung, welche wie gewöhnlich in den Ofen kommen,
durchströmt.
Fig. 1 ist ein
senkrechter Längendurchschnitt von einem Kupolofen, der
nach den Verbesserungen der HHrn. Wright und Brown eingerichtet ist. Fig. 2 ist ein
entsprechender horizontaler Durchschnitt. Fig. 3 ist ein senkrechter
Durchschnitt eines Hohofens mit Heizkammern nach dem
neuen Princip, und Fig. 4 der entsprechende horizontale Durchschnitt.
In Fig. 1 und
2 strömt
die kalte Luft aus dem Cylinder- oder Ventilator-Gebläse mittelst der
Röhre A in den Kupolofen,
geht alsdann bei B durch die Mauer desselben und bei C in den Mittlern Theil des Ofens. Da dieser die Luft
zuerst aufnehmende Theil des Kupolofens mit zusammengepreßter Luft angefüllt wird,
welche durch die darüber befindlichen Schmelzmaterialien am Aufwärtsströmen
gehindert ist, so entsteht nothwendig ein theilweis abwärtsgehender Strom. Die Luft
strömt daher abwärts und zwar aus C durch die
senkrechten Scheidewände D, mittelst der Gewölbe E, welche bis zur Sohle F
geöffnet sind. Die Luft gelangt auf diese Weise in die Kammern G, welche ebenfalls bis zur Sohle reichen, die hier,
sowie in dem Mittlern Theil C großentheils mit
geschmolzenen Materialien bedeckt ist. Die Pfeile bezeichnen die Strömungsrichtungen
des Windes und zeigen wie er nach den äußersten Enden der Kammern G circulirt und längs den Gewölben H derselben zurückströmt. Die Luft wird dadurch sehr
stark erhitzt und mit dieser hohen Temperatur strömt sie in den Haupttheil des
Kupolofens zurück, und zwar durch die Formen oder Oeffnungen I in den Wänden D. Sie durchströmt dort die
Stücke des einzuschmelzenden Roheisens und der Kohksgichten, wie dieß in allen
Schachtöfen der Fall ist. Dem Kupolofenschacht kann man jede beliebige Form geben.
Das niederschmelzende Roheisen sammelt sich nach und nach auf der Sohle und wird
durch die Abstichöffnung K auf gewöhnliche Weise
abgestochen. Die Erhitzungskammern kann man mit einer stärkern oder schwächern Sohle
von feuerfestem Sand und Thon versehen, je nachdem man mehr oder weniger flüssiges
Eisen in dem Ofen halten will. Die Schlacken werden durch L abgelassen.
Bei dem in Fig.
3 und 4 dargestellten Hohofen strömt die Gebläseluft
durch die vier Formen oder Röhren B ein, welche in
regelmäßigen Entfernungen von einander angebracht sind. Dieser vierfache Strom
unterhalt einen constant gleichförmigen Luftdruck in dem Mittlern Raum C, unter der Masse der Schmelzmaterialien. Diese
verdichtete Luft kann nur durch die vier Gewölbe D
entweichen, zwischen denen die vier Formen angebracht sind. Auf diese Weise wird der
Gebläsewind in Berührung mit der geschmolzenen Masse von Materialien am Boden E des Ofens gebracht, sowie auch mit derjenigen welche
sich in den Gewölben D und den mit denselben in
Verbindung stehenden äußern Kammern G befindet. Diese
erhitzte Luft steigt dann in den Kammern G in die Höhe,
strömt nach dem Ofen zurück und durch die Röhren oder Formen H in denselben ein, um die Schmelzmaterialien im Gestell, auf der Rast und
im Schacht zu durchdringen. Die Schlacken fließen durch die Oeffnung K ab, während man das flüssige Eisen durch die Oeffnung
L absticht.
Dieses System von Oefen mit Selbsterhitzung der Gebläseluft kann mit sehr
verschiedener Gestalt der Kammern und Oeffnungen ausgeführt und auf alle Arten von
Schmelzöfen mit großer Ersparung angewendet werden.
Tafeln