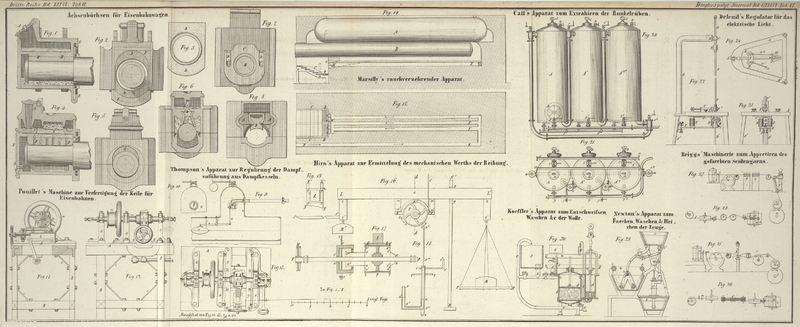| Titel: | Apparat zum Entschweißen, Waschen und Entfetten der Wolle, welchen sich L. Chr. Köffler zu Rochdale, am 31. Jan. 1854 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 136, Jahrgang 1855, Nr. XCVI., S. 438 |
| Download: | XML |
XCVI.
Apparat zum Entschweißen, Waschen und Entfetten
der Wolle, welchen sich L. Chr.
Köffler zu Rochdale, am 31. Jan.
1854 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, März 1855, S.
151.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
Köffler's Apparat zum Entschweißen etc. der Wolle.
Die für das Verspinnen zu entschweißende Wolle kommt in einen geschlossenen Behälter,
welcher von einem besonderen Behälter aus mit der zur Entschweißung dienenden
Auflösung gefüllt wird. Mittelst Dampf treibt man nun die Flüssigkeit durch die
Wolle und wieder in ihren ursprünglichen Behälter zurück. Hierauf preßt man auf
ähnliche Weise Wasser durch die Wolle. Um nun auch das Oel zum Einfetten zu
appliciren, läßt man das
Wasser, womit die Wolle getränkt ist, durch eine darüber befindliche Oelschichte
verdrängen.
Fig. 30
stellt den zu diesen Proceduren dienenden Apparat im senkrechten Durchschnitte dar.
Auf dem Gestell a befindet sich ein an beiden Enden
geschlossener Behälter b, welcher am Boden mit einer
durchlöcherten Platte c versehen ist. In diesem Behälter
befindet sich ein durchlöcherter Kolben d, dessen Stange
durch eine Stopfbüchse tritt und an ihrem oberen Ende mit einer Kette und Rolle
verbunden ist, mittelst deren er nach Belieben gehoben oder niedergelassen werden
kann. Eine an dem Boden des Behälters b befindliche
Oeffnung steht mit einer Röhre e in Verbindung, welche
mit einem Hahn f versehen ist und aufwärts nach einem
Behälter g führt, der die reinigende Flüssigkeit
enthält. Der Boden dieses Behälters steht durch eine mit Hähnen i, j versehene Röhre h mit
dem Inneren des Behälters b in Verbindung. Eine andere
durch den Hahn m verschließbare Röhre l führt aus einem Wasserbehälter in die Röhre h. Eine dritte mit einem Dampfkessel in Verbindung
stehende Röhre führt gleichfalls in die Röhre h; sie ist
mit einem durch einen Hahn p verschließbaren Seitenrohr
o versehen. Das Oel, womit die Wolle eingefettet
werden soll, befindet sich in einem kleinen Behälter q,
aus dem es in die Röhre h fließen kann; der Hahn r dient zur Regulirung des Zuflusses. Auf dem Gestell
a ist eine Luftpumpe A
von gewöhnlicher Construction gelagert, aus welcher die Luft durch das Ventil s und die Röhre t in den
oberen Theil des Behälters b getrieben werden kann. Die
Wolle wird nach abgenommenem Deckel, den man sodann wieder aufsetzt, auf den
durchlöcherten Boden c des Behälters b geschichtet und der Kolben d darüber gedeckt. Die Hähne f, i, o, r, m
sind geschlossen, der Hahn j dagegen offen, so daß die
entschweißende Flüssigkeit in den Behälter b auf den
Kolben d fließen kann, dessen siebartige Löcher die
Flüssigkeit über die Oberfläche der Wolle vertheilen. Wenn auf diese Weise eine
hinreichende Quantität Flüssigkeit eingefüllt ist, so wird der Hahn j geschlossen und die Luftpumpe in Bewegung gesetzt. Die
durch letztere in den Behälter b gepreßte Luft treibt
nun die Flüssigkeit durch die Wolle in die Röhre e und
von da in den Behälter g zurück. Ist dieses geschehen,
so wird der Hahn j wieder geöffnet, neue Flüssigkeit in
den Behälter b gelassen, die Luftpumpe in Thätigkeit
gesetzt und die nämliche Operation so oft wiederholt, als man es nothwendig findet.
Nach vollbrachter Reinigung der Wolle wird der Hahn j
geschlossen und mittelst Oeffnens des Hahns m Wasser
zugelassen; durch den Hahn f läßt man dieses wieder
abfließen; zur Beförderung dieses Ausflusses kann die Luftpumpe wieder in Thätigkeit
gesetzt werden. Die Größe des Luftdruckes in dem Behälter B läßt sich zu
jeder Zeit mittelst des Manometers B untersuchen. Zur
Beseitigung jeder Gefahr ist noch ein Sicherheitsventil angebracht. Anstatt des
Luftdrucks kann man auch Dampfdruck anwenden; dieses gilt jedoch nur für die Fälle,
wo man sich zum Entschweißen keines Alkali's bedient, weil sonst der Wasserdampf
schädlich wirken würde. Die zum Entschweißen dienende Flüssigkeit kann in dem
Behälter g durch ein System von Dampfröhren oder auf
sonstige Weise erwärmt werden.
Nach dem Ablassen des Spülwassers befindet sich die Wolle in einem ziemlich
comprimirten Zustande. Es wird nun so viel Wasser in das Gefäß eingelassen, daß
dasselbe die Wolle vollständig bedeckt, und darauf das Oel durch Oeffnen des Hahnes
r zugeführt; die Hähne i, j,
m, o werden geschlossen. Auf die Oberfläche des über dem Wasser
schwimmenden Oels wird mittelst der Luftpumpe ein Druck ausgeübt, welcher das Wasser
durch den geöffneten Hahn f hinaustreibt. Das Oel
durchdringt nun die ganze Masse der Wolle ganz gleichförmig. Das starke Bestreben
des Oels, sich mit der Wolle zu vereinigen, verursacht daß das Wasser ohne
Zurücklassung merklicher Spuren sich entfernt, und die Wolle wird für die
Vorarbeiten des Spinnens trocken genug.
Tafeln