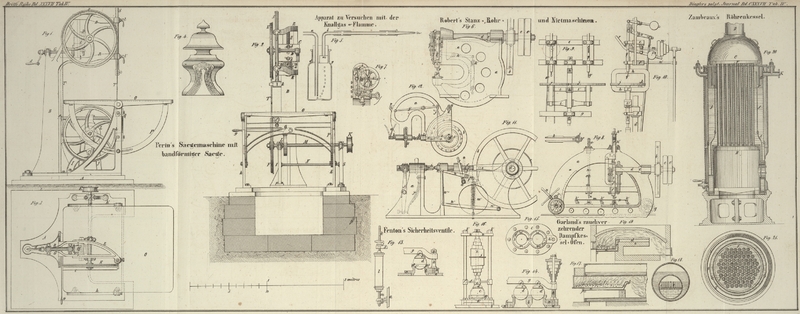| Titel: | Verbesserungen an Sicherheitsventilen, welche sich James Fenton zu Bradford in Yorkshire, am 1. Mai 1854 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. LXV., S. 243 |
| Download: | XML |
LXV.
Verbesserungen an Sicherheitsventilen, welche
sich James Fenton zu Bradford in Yorkshire, am 1. Mai 1854
patentiren ließ.
Aus dem London Journal of
arts, Juni 1855, S. 344.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Fenton's Verbesserungen an Sicherheitsventilen.
Fig. 13
stellt ein Locomotive-Sicherheitsventil im Aufriß, den Ventilsitz im
Durchschnitte dar. a, a ist ein Theil der Kesselplatte;
b, b das messingene Gehäuse des Ventilsitzes,
welches mittelst der Flansche c an den Kessel geschraubt
ist. c*, c* der nach dem Kugelventil d genau abgedrehte und abgeschliffene Ventilsitz; c², c² vier
Führungen, welche das Ventil beim Herabfallen genau in seinen Sitz leiten. Das
Ventil d ist hohl gegossen und möglichst genau sphärisch
abgedreht. e ist eine kugelförmige Schale, welche nach
dem obern Theile des Ventils d abgeschliffen ist. f ist eine mit der Schale im Ganzen gegossene
Hervorragung mit einem halbkugelförmigen Ende, welches in eine entsprechende
halbkugelförmige Vertiefung in der unteren Seite des Hebels paßt. h ist eine verticale an den Ventilsitz geschraubte
Spindel. Diese Spindel geht oben in eine Schraube aus, auf welche die Mutter i paßt, deren untere sphärische Fläche sich in eine
entsprechende sphärische Vertiefung des Hebels g legt.
An dieser Stelle ist ein conisches Loch durch den Hebel gebohrt, so daß derselbe
über das Ende der verticalen Spindel geschoben werden kann. Hier wird er durch die
Mutter i zurückgehalten, welche zugleich als Stützpunkt
des Hebels wirkt. Das andere Ende des Hebels ist mit einer ähnlichen Schraubenmutter
und Oeffnung j versehen, durch welche das Ende der
Spindel k einer gewöhnlichen Federwaage l tritt. Die Büchse der Federwaage ist an ihrem unteren
Ende mit einer Schraubenspindel m versehen, welche durch
den Arm n tritt und eine Mutter o enthält. Der Hebel g ist an beiden Enden
abwärts gebogen, um die Mittelpunkte der sphärischen Muttern mit der Centrallinie
des Hebels in gleiche Richtung zu bringen und dadurch die Wirkung des Ventils
genauer und sicherer zu machen.
Fig. 14
stellt eine Modification der beschriebenen Einrichtung dar, bei welcher zwei Ventile
in Anwendung kommen. Jedes Ventil ist genau nach dem gleichen Princip construirt.
Fig. 15
ist der Grundriß des Ventilsitzes. Bei dieser Anordnung wird der Maschinenwärter außer Stand gesetzt,
die Dampfspannung im Kessel durch Anhängung eines Gewichtes an den Hebel g übermäßig zu steigern, indem jedes Ventil dem andern
als Hebelstützpunkt dient. Sollte daher der Maschinist unerlaubter Weise das nächst
der Federwaage befindliche Ventil schließen wollen, so würde er dadurch das andere
öffnen. p ist eine zwischen der Mutter i und dem Ende des Hebels g
angeordnete schneckenförmige Feder, welche je nach ihrer Adjustirung im Sinne eines
Stützpunktes oder eines Belastungsgewichtes wirkt. Denn sollte die Federwaage so
weit niedergeschraubt werden, daß sie einen größeren Druck aushalten würde als die
Schneckenfeder, so würde letztere beim Ausströmen des Dampfs durch das Ventil
comprimirt werden; im umgekehrten Falle aber würde die Schneckenfeder dem Hebel als
Stützpunkt dienen und dagegen die Federwaage durch den Dampfdruck gehoben
werden.
Fig. 16
stellt ein Sicherheitsventil für stationäre oder Marinedampfkessel mit einem Paar
direct auf das Ventil wirkender Schneckenfedern im Aufrisse dar. a*, a* ist der an die Kesselplatte b geschraubte Ventilsitz; c
das Kugelventil; d eine Schüssel mit halbkugelförmiger
Spindel e, welche in eine an der unteren Seite des
Querstücks f befindliche Schüssel paßt. Das Querstück
f gleitet an den Säulen g,
g auf und nieder, deren obere Enden durch das Querstück h mit einander verbunden sind. i,
i sind zwei auf das Ventil c direct wirkende
Schneckenfedern; j ist eine zwischen beiden Federn
angeordnete Scheibe; k eine durch die Federn sich
erstreckende, an das Querstück h befestigte Spindel,
welche den Federn als Führung dient.
Tafeln