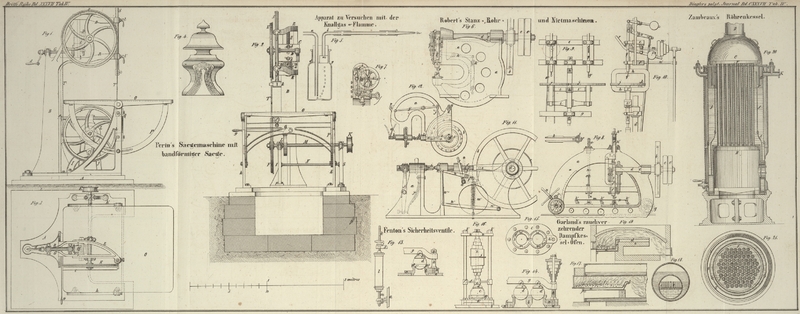| Titel: | Ueber einen einfachen und gefahrlosen Apparat zu Versuchen mit der Flamme des Knallgases; von Prof. Ineichen in Luzern. |
| Fundstelle: | Band 137, Jahrgang 1855, Nr. LXXVII., S. 298 |
| Download: | XML |
LXXVII.
Ueber einen einfachen und gefahrlosen Apparat zu
Versuchen mit der Flamme des Knallgases; von Prof. Ineichen
in Luzern.
Aus
Poggendorff's
Annalen der Physik und Chemie, 1855, Nr. 6.
Mit einer Abbildung auf Tab. IV.
Ineichen, über einen Apparat zu Versuchen mit der Flamme des
Knallgases.
Wird das aus einer engen Röhre ausströmende Knallgas (ein Gemenge von 2 Vol.
Wasserstoff und 1 Vol. Sauerstoff) angezündet, so kann es bekanntlich geschehen, daß
die Flamme bei nachlassendem Drucke des Gases in die Röhre zurücktritt und eine
gefährliche Explosion und Zerschmetterung des Gasbehälters verursacht. Um dieser Gefahr vorzubeugen,
hat man bisher, soviel mir bekannt ist, vorzüglich zwei verschiedene
Sicherheitsmittel angewendet. Das erste besteht darin, daß man die Röhre, durch
welche das Gasgemenge aus dem Behälter strömen soll, auf eine Länge von 2 bis 3 Zoll
mit dicht an einander liegenden Scheibchen von feinem Metallgewebe füllt, so daß das
Gas durch dieses vielfache Gewebe herausströmen, die Flamme hingegen nicht durch
dasselbe zurücktreten kann. Das andere Mittel besteht darin, daß jedes der beiden
Gase aus einem eigenen Behälter und durch eine besondere Röhre ausströmt und beide
Röhren sich in einiger Entfernung zu einer einzigen vereinigen, so daß die zwei Gase
sich erst nahe an der Ausmündung vermengen können. Nähere Beschreibungen dieser
Apparate findet man in Poggend. Annalen Bd. CXVI S. 547
ganze Folge, ferner im Löthrohrbuch von Th. Scheerer 1851
und in Heßler's Lehrbuch der Physik 1854, wo dieser
Apparat in seiner Anwendung zum Gasmikroskop beschrieben wird. Diese Apparate können
zwar gefahrlos gemacht werden, sind aber ziemlich complicirt und mit nicht geringen
Kosten verbunden; auch dürfte bei dem letzteren, wo die beiden Gase in abgesonderten
Behältern gehalten werden, die Regulirung der Hähne und des Druckes nicht immer so
gelingen, daß die zwei Gase im richtigen Verhältniß gemengt zur Flamme gelangen, was
doch nothwendig ist, wenn der Effect das Maximum erreichen soll. Da diese Apparate
in den neuesten Werken beschrieben werden, so bin ich dadurch veranlaßt worden, hier
die Einrichtung meines Apparates mitzutheilen, welcher mit jeder wünschbaren
Sicherheit eine solche Einfachheit verbindet, daß derselbe von jedem Laboranten
selbst und ohne Kosten hergestellt werden kann, indem dazu nichts anderes erfordert
wird, als was in jedem Laboratorium ohnedieß vorhanden ist.
Das Wesentliche desselben besteht darin, daß bei einem allfallsigen Rücktritt der
Flamme dieselbe sich nur einer möglichst kleinen Menge von Knallgas, nie aber dem
ganzen Vorrath desselben im Gasbehälter mittheilen kann. Dieser Zweck wird
vollkommen erreicht durch die Einrichtung, welche Fig. 5 darstellt. Durch
den Kork, welcher in den Hals eines etwas starken Glases eingepaßt ist, werden zwei
gebogene Glasöhren gesteckt. Die eine a reicht 6 bis 7
Centimeter unter die Oberfläche des Wassers, womit das Glas bis an den Kork d, g gefüllt ist; das äußere Ende derselben ist
vermittelst einer Kautschukröhre mit einer Messingröhre verbunden, welche mit einem
Hahne versehen und entweder mit einer Schweinsblase oder einem Gasbehälter
(Gasometer) in Verbindung steht. An der Stelle, wo die Röhre b eingesteckt wird, ist der Kork unterhalb bei m etwas ausgeschnitten, so daß zwischen diesem Theil der Korkfläche und der Wasserfläche d, g ein kleiner Raum ist. Die Röhre b ist dann ferner vermittelst einer Kautschukröhre mit
einer etwa 4 Decimeter langen und 1 Millimeter weiten Glasröhre verbunden; auf
gleiche Weise wird an das Ende derselben eine Löthrohrspitze angesteckt. Wird nun
auf das Gasgemenge in der Schweinsblase oder im Gasbehälter ein angemessener Druck
ausgeübt, so strömt dasselbe unter das Wasser im Glas und von da durch die Röhre b bis an die Mündung der Löthrohrspitze, wo es
angezündet wird. In dieser Flamme können dann die bekannten Versuche über das
Siderallicht mit dem Kalkcylinder (Drummond's
Beleuchtung), die Schmelzung des Platins, die Verbrennung des Eisens und Stahls
u.s.w. vorgenommen werden; auch läßt sich diese Vorrichtung so gut wie jede andere
zum Gasmikroskop gebrauchen.
Bei dieser Anordnung des Apparats kann die Flamme niemals in den Gasbehälter, von
welchem sie durch die Wassersäule im Glase abgeschnitten ist, zurücktreten, wohl
aber zu dem kleinen Gasvolum bei m zwischen dem
ausgeschnittenen Kork und der Wasserfläche. Dieses Gasvolum kann aber so klein
gemacht werden, daß nie eine Explosion zu besorgen ist. Bei meinen Experimenten über
die Knallgasflamme bewirke ich oft durch Nachlassung des Druckes absichtlich das
Zurücktreten der Flamme um das gefahrlose Verhalten des Apparates zu zeigen. Beträgt
das Gasvolum bei m etwa 27 Kubikcentimeter, so erhält
das Glas eine geringe aber gefahrlose Erschütterung; wird das Volum kleiner gemacht,
so wird auch die Erschütterung geringer, und ist gar nicht mehr wahrzunehmen, wenn
das Volum auf 12 oder 10 Kubikcentimeter reducirt wird. Dieses Volum kann leicht
durch Abwägen des Wassers bestimmt werden, welches dieser kleine Raum fassen kann,
indem 1 Grm. Wasser 1 Kubikcentimeter einnimmt. Dieser Raum kann zwar beliebig
reducirt werden, jedoch ist dafür zu sorgen, daß die Mündung der Röhre bei m und die betreffende Korkfläche wenigstens um 1
(Centimeter von der Wasserfläche d, g abstehe, weil bei
einem zu geringen Abstand das aufsteigende Gas leicht Wasser in die Röhre
hinaufwirbeln könnte.
Tafeln