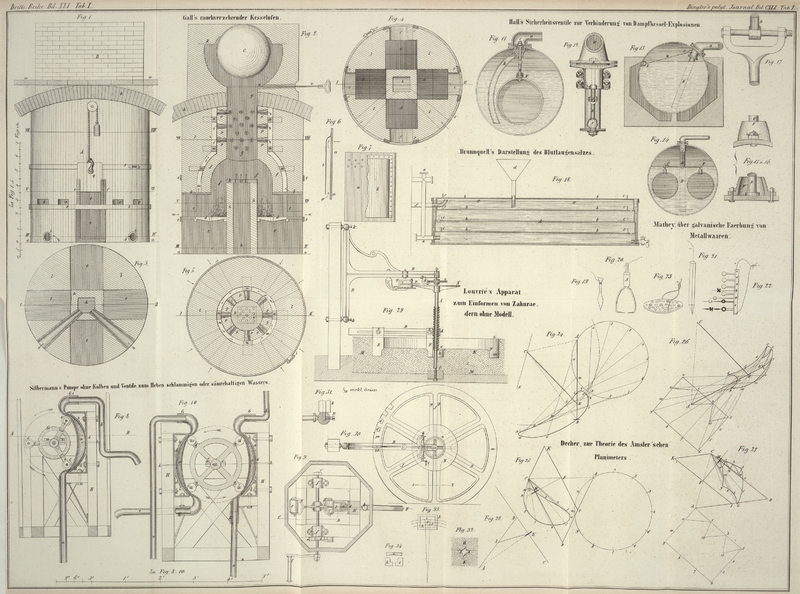| Titel: | Ueber die galvanische Färbung von Metallwaaren; von A. O. Mathey, Probirer am Controleamt zu Locle in der Schweiz. |
| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. VI., S. 33 |
| Download: | XML |
VI.
Ueber die galvanische Färbung von Metallwaaren;
von A. O. Mathey, Probirer
am Controleamt zu Locle in der Schweiz.
Aus dem Technologiste, October 1855, durch das
polytechnische Centralblatt, 1856, S. 612.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Mathey, über die galvanische Färbung von Metallwaaren.
Der Verf. hat viele Versuche angestellt über die Färbung von Metallgegenständen auf
galvanischem Wege (Galvanochromie), d.h. durch galvanische Ablagerung einer ganz
dünnen Schicht eines Metalloxyds auf denselben, welche Schicht, in gleicher Weise
wie das beim Anlassen des Stahls entstehende Oxydhäutchen, je nach ihrer Dicke den
Gegenständen verschiedene Farben gibt. Veranlassung zu diesem Verfahren war die in
der Schweiz von diesem Verfahren gemachte Anwendung zum Färben verschiedener Theile
von Uhren. Die Oxyde, welche der Verf. bisher hauptsächlich anwendete, sind
Bleisuperoxyd und Eisenoxyd.
Bereitung der Bleilösung. Man löst 425–450 Grm.
caustisches Kali in einem Liter destillirten Wassers, fügt ungefähr 125 Grm.
Bleioxyd, am besten Massicot, hinzu, und kocht die Mischung 10 Minuten lang in einem
Kolben mit engem Halse, damit die Luft möglichst wenig Zutritt habe. Nach dem
Erkalten decantirt man die Lösung von dem ungelöst gebliebenen Bleioxyd und verdünnt
sie mit destillirtem Wasser, bis sie am Baumé'schen Aräometer
24–25° zeigt, indem diese Dichtigkeit die geeignetste ist, um schöne
Farben zu erhalten. Man bewahrt sie in einer gut verschlossenen Flasche auf, damit
nichts Fremdartiges hineinkommt. Beim Gebrauche der Lösung bildet sich darin
allmählich kohlensaures
Kali. Man kocht sie dann mit caustischem Kalk, läßt absetzen und benutzt die klare
Flüssigkeit aufs Neue. Von Zeit zu Zeit muß man die Flüssigkeit wieder mit Bleioxyd
kochen. Benutzt man dieselbe zum Färben von Gegenständen, die rauhe Stellen haben,
so kommt es vor, daß dieselben keine gleichförmige Farbe annehmen. Die Ursache davon
liegt nach dem Verf. wahrscheinlich darin, daß die Flüssigkeit die Elektricität
nicht so gut leitet wie das Metall, und man kann diesem Fehler leicht abhelfen,
indem man das Leitungsvermögen derselben durch Zusatz einer Säure vergrößert. Man
setzt oft zu diesem Zwecke Weinstein zu, welcher aber nach dem Verf. am wenigsten
geeignet ist und besser durch Oxalsäure, Essigsäure u.s.w. ersetzt wird. Am besten
ist es, überhaupt keine Säure zuzusetzen, weil ein solcher Zusatz die Solidität der
Farben sehr beeinträchtigt und man auch ohne denselben den Zweck vollständig
erreichen kann. – Massicot ist für den vorliegenden Zweck besser, als
Bleiglätte, weil es sich leichter in Kali auflöst. Man bereitet es sich
nöthigenfalls selbst, indem man Mennige in einem unglasirten irdenen Gefäße unter
beständigem Umrühren mit einem Eisenstabe bis zum dunkeln Rothglühen erhitzt, bis
eine Probe der Masse nach dem Erkalten eine citronengelbe Farbe zeigt. Zu starkes
Erhitzen muß vermieden werden, da das Oxyd dann schmelzen würde.
Bereitung der Eisenlösung. Obschon diese Lösung in der
Bereitung und Anwendung Schwierigkeiten darbietet, kann sie doch eine häufige
Anwendung finden, und sie ist sogar in gewissen Fällen unentbehrlich, weil sie
Nüancen gibt, die man mit Bleilösung nicht erhalten kann. Man löst Eisenvitriol, der
eine blaßgrüne Farbe besitzt und sich nicht oxydirt hat, in der Wärme in
destillirtem Wasser, kocht die Lösung, um alle Luft daraus auszutreiben, und hebt
sie in einer dicht verschlossenen Flasche auf. Wenn man sie gebrauchen will, gießt
man die nöthige Menge davon aus der Flasche heraus und vermischt sie mit luftfreiem
Ammoniak, bis der entstandene Niederschlag sich wieder aufgelöst hat (was er aber,
wenn man nicht zugleich eine Säure oder ein Ammoniaksalz zusetzt, nicht vollständig
thut). Die so bereitete Lösung kann man nicht länger als eine Stunde lang benutzen,
weil durch die Einwirkung des Sauerstoffs der Luft Eisenoxyd daraus niedergeschlagen
wird. Die Farben, welche man mittelst derselben erhält, sind viel weniger
veränderlich, als die mit der Bleilösung erhaltenen, sie sind lebhafter und ebenso
solide, als das Blau, welches durch Anlassen auf Stahl hervorgebracht wird.
Vorbereitung der zu färbenden Gegenstände. So viel als
möglich bringt man die galvanische Färbung auf einer nicht oxydirbaren Metallschicht an, da der
Gegenstand mit dem positiven Pole verbunden werden muß und er, wenn seine Oberfläche
aus einem oxydirbaren Metall besteht, dabei oft nicht blank bleibt. Als Unterlage
für das aus der Bleilösung sich ausscheidende Bleisuperoxyd eignet sich vorzüglich
Gold oder eine vergoldete Fläche, oder auch Platin. Auf letzterem bringt das
Bleisuperoxyd ein prächtiges Blau, auf Gold dagegen Grün hervor. Dieß rührt davon
her, daß die Farbe des Metalls durchschimmert; das gelbe Gold wird also grün,
während Platin, Stahl, Argentan die blaue Farbe nicht verändern.Auf Stahl und Argentan erhält man indeß das Blau und das Grün. Die grüne
Farbe wird also auch durch die Lösung hervorgebracht und rührt nicht bloß
von dem unterliegenden Metall her. Warum sie aber doch auf Platin nicht
entsteht, kann der Verf. nicht angeben. Auf Argentan und den anderen weißen Metallen erscheint die grüne Farbe erst,
nachdem sie zuvor blau geworden sind. Die Färbung des Silbers kommt der der übrigen
Metalle nicht gleich, weil dasselbe schnell eine Oxydation erleidet, welche seine
Oberfläche matt macht und das Erscheinen der Farben verhindert. Die Legirungen,
welche Silber, wenn auch nur in kleiner Menge, enthalten, färben sich deßhalb nicht
gut und verändern sich schnell, weßhalb man das Silber bei diesem Verfahren
sorgfältig vermeiden muß.
Der gute Erfolg der Operation hängt vor Allem von der gehörigen Reinigung und
Vorbereitung des Gegenstandes ab. Je besser derselbe polirt ist, desto lebhafter
werden die Farben; eine mit dem Polirstahle geglättete Fläche wird schöner, als eine
bloß mit Eisenoxyd polirte. Vor dem Färben muß jedes Stück sorgfältig gereinigt und
namentlich von aller fettigen Substanz befreit werden; man taucht es zu diesem
Zwecke in Kalilauge, oder besser in eine Lösung von Kali in Weingeist, und spült es
darauf in Wasser; für große Artikel kann man auch Kreide anwenden. Nach der
Reinigung darf man die Gegenstände nicht mehr mit den Fingern oder mit einem Tuche
berühren.
Der galvanische Apparat. Becquerel wendete zur
Galvanochromie eine einfache Kette an, bestehend aus einem porösen Cylinder, welcher
die Bleilösung enthält und welcher innerhalb eines weiteren Glasgefäßes in
verdünnter Salpetersäure steht. In der Salpetersäure steht ein Platinblech, welches
einen Leiter trägt, mit welchem der zu färbende, in die Bleilösung tauchende
Gegenstand verbunden ist. Der Verf. zieht es aber vor, eine besondere kleine
constante Batterie von bloß zwei Paaren anzuwenden. Die Leitungsdrähte, ebenso wie
die negative Elektrode, sind von Eisen oder Platin. Die Elektrode endet gewöhnlich
mit einer Spitze (Fig. 19), wenn
man Uhrzeiger färben will. Ist der zu färbende Gegenstand groß und sollen beide
Seiten desselben gefärbt werden, so reicht die Elektrode Fig. 19 nicht aus; man
kann dann eine Elektrode anwenden, wie Fig. 20 zeigt, bestehend
aus mehreren Drähten, die unten gebogen und mit den Spitzen gegen einander gekehrt
sind. Der Gegenstand wird dann in der Mitte zwischen diesen Spitzen angebracht. Die
verschiedenen Drähte laufen oben zusammen und werden durch den Kork A gehalten. Am oberen Ende stehen sie mit dem negativen
Pole in Verbindung. Solcher Drähte kann man auch viele anwenden, so daß ihre Enden
in der Flüssigkeit dem Gegenstande büschelförmig gegenüber stehen. Um einen
halbkugelförmigen Gegenstand im Innern zu färben, setzt man ihn mit dem positiven
Pole in Verbindung, füllt ihn mit der Lösung und stellt die negative Elektrode
hinein, so daß die Spitze in der Mitte steht. Eine gewöhnliche Elektrode, mit
welcher die Arbeit gut gelingt, besteht aus einem in einem Glasrohre
eingeschlossenen Eisen- oder Platindrahte, welcher um ungefähr 1/2 Millimeter
aus dem ausgezogenen Ende des Glasrohres hervorsteht (Fig. 21). Für runde
Gegenstände, z.B. kleine Glocken, kann man als negativen Pol ein cylindrisches
bleiernes Gefäß benutzen, welches die Bleilösung enthält; der mit dem positiven Pole
verbundene Gegenstand wird dann mitten in diese Lösung gehängt.
Ausführung der Arbeit. Sey vorausgesetzt, daß man
Uhrzeiger färben wolle. Man bringt 6 Paare derselben auf einem stählernen Rechen an,
dessen Zweige die geeignete Form und Elasticität haben, um die Zeiger mit ihren
Hülsen daran zu befestigen. Zur Versinnlichung dieses Instruments gibt der Verf. die
Abbildung Fig.
22. Der Leiter A wird mit dem positiven Pole
in Verbindung gesetzt und der Rechen mit den Zeigern in die Flüssigkeit eingetaucht.
Indem man ihm durch einige gelinde Stöße eine Erschütterung gibt, bewirkt man, daß
die in den Löchern der Zeigerköpfe zurückgehaltenen Luftblasen entweichen. Der
Rechen muß ungefähr 25 Millim. hoch von Flüssigkeit bedeckt seyn; wollte man ihn
tiefer eintauchen, so könnte man die entstehenden Farben nicht gut beobachten und
würde nicht so leicht die gewünschte Nüance erhalten. Wenn alles so vorgerichtet,
führt man die negative Elektrode (Fig. 19 oder 21) an der
Oberfläche der Flüssigkeit umher, so daß bloß ihre Spitze eingetaucht ist. Nach
5–6 Secunden sieht man die Zeiger sich verändern; man läßt die erste Ordnung
der Farben vorübergehen; wenn sie grau sind, beginnt die zweite Ordnung. Das Grau
verschwindet nämlich, um einer gelben Farbe Platz zu machen, welche dann ebenfalls
verschwindet und durch Roth ersetzt wird. Dieser Moment erfordert alle
Aufmerksamkeit, damit man nicht die Nüance, welche man haben will, vorübergehen lasse, und man muß
dabei beachten, daß die Farben in der Flüssigkeit weniger dunkel erscheinen, als sie
wirklich sind. Sehen sie in der Flüssigkeit roth aus, so sind sie in Wirklichkeit
nachher violett. Wenn man sie roth erhalten will, muß man sie also schon
herausnehmen, wenn sie in der Flüssigkeit orange erscheinen. Sollte die Spitze des
Zeigers die beabsichtigte Farbe früher erhalten als der Kopf, so hebt man die Spitze
aus der Flüssigkeit heraus, während der noch nicht hinreichend gefärbte Theil noch
eingetaucht bleibt, und läßt nun den Strom unterbrochen wirken, d.h. taucht die
Spitze der negativen Elektrode wiederholt abwechselnd einen Augenblick in die
Flüssigkeit, bis die gewünschte Farbe überall entstanden ist. Die Dauer der
Operation variirt von 10–40 Secunden. Es ist vortheilhaft, eine größere
Anzahl von Zeigern auf einmal zu behandeln, weil sie dann gleichförmiger in der
Farbe ausfallen.
Der Verfasser theilt bezüglich dieser Operation noch folgende Bemerkungen mit: 1) Ist
der Strom zu stark, so sieht man an den Elektroden Wasserstoff- und
Sauerstoffgas sich entwickeln. Der Gegenstand nimmt dann ein grauliches Ansehen an
und die Elektrode aus Eisen bedeckt sich mit schwammförmigem Blei. Unter diesen
Umständen muß man den Strom schwächer machen, und, nachdem man den Gegenstand wieder
polirt hat, die Operation aufs Neue beginnen. 2) Eine Messingplatte von einer
gewissen Größe der Wirkung des Stromes ausgesetzt, bleibt passiv und nimmt durchaus
keine Farbe an. Zeigt sich dieß, so muß man die Platte erst mit einem kleinen Theil
eintauchen, und in dem Maaße, als sie die Farbe ändert, sie weiter einsenken. 3) Ist
der Gegenstand groß, so nimmt er unfehlbar mehrere Farben an, weil die von der
Verbindungsstelle mit dem Poldrahte am entferntesten Theile sich am schnellsten
färben. Dieß macht sich um so mehr geltend, je weniger gut die Flüssigkeit leitet.
Um diesem Uebelstande entgegen zu wirken, muß man die Gegenstand an verschiedenen
Stellen mit dem positiven Pole verbinden und die negative Elektrode in mehrere
zweckmäßig angeordnete Drähte auslaufen lassen. 4) Ein frisches Bad bringt immer auf
derselben Platte mehrere Nüancen hervor und beim Gebrauche wird das Bad besser. Man
lasse daher die auf ihrem Rechen angebrachten Zeiger erst einige Minuten lang in dem
frischen Bade verweilen und färbe sie dann in einem alten Bade. 5) Ist die Farbe
nicht gut ausgefallen, so wird der Gegenstand in starkem Essig abgebeizt und dann
aufs Neue gefärbt. Man kann so den Gegenstand 2 oder 3 Mal dem Färben unterwerfen,
ohne ihn wieder zu Poliren, wenn er aus wenigstens 14karatigem Gold besteht. 6) Hat
man einen vergoldeten Gegenstand 5–6 Male dem Färben unterworfen, so ist die
Vergoldung
vollständig weggenommen, so daß man ihn aufs Neue vergolden und glätten muß. 7)
Bringt man einen gefärbten Gegenstand in der Bleilösung mit dem negativen Pole in
Berührung, so verschwindet seine Farbe, indem das Bleisuperoxyd sich auflöst. Dieses
Mittel, die Farbe von dem Gegenstande wegzunehmen, verdient vor der Benutzung des
Essigs den Vorzug.
Erzeugung verschiedener Farben an demselben Gegenstande.
Um z.B. ein in Metall gearbeitetes Blumenbouquet, welches etwa für eine Broche oder
Haarnadel bestimmt ist, mit mehreren Farben zu versehen, wird es, wenn es nicht von
Gold ist, zunächst stark (galvanisch) vergoldet und nach Umständen mattirt. Man
überzieht dann mittelst eines Pinsels diejenigen Stellen, welche die Goldfarbe
behalten sollen, mit schwarzem Aussparfirniß (epargne noire
liquide) und bringt den Gegenstand darauf, mit dem positiven Pole
verbunden, in das Bleibad. Wenn alle Blumen Hellroth geworden sind, bedeckt man
diejenigen von ihnen, welche diese Farbe behalten sollen, ebenfalls mit dem Firniß,
und läßt darauf durch Wiedereinbringen in das Bleibad die übrigen violett werden.
Man kann nun diejenigen, welche violett bleiben sollen, mit dem Firniß überziehen
und darauf die übrigen blau werden lassen. Ueberzieht man endlich auch die blau
gewordenen Blumen mit Firniß, so daß nur noch die Blätter unbedeckt sind, und bringt
wieder in das Bad, so werden die Blätter grün. Das Grün kann man auch noch
nüanciren, weil erst ein dunkleres und dann ein helleres Grün auftritt, welches
zuletzt in Gelb übergeht. Ist der Gegenstand in dieser Weise gefärbt, so befreit man
ihn durch Behandeln mit Terpenthinöl in der Kälte von dem Firniß, und reinigt ihn
dann erst durch Seifenwasser mittelst einer weichen Bürste und darauf mit warmem
Wasser und einem Tuche. Diese verschiedenen Farben, welche die natürlichen Farben
der Blumen nachahmen und auf einen Grund von mattem Gold oder Silber aufgesetzt
sind, machen einen herrlichen Effect, und lassen, was die Lebhaftigkeit und den
Glanz anbetrifft, die auf Email ausgeführte Malerei weit hinter sich, besitzen aber
leider nicht die Dauerhaftigkeit derselben. Einzelne versilberte Blumen mit
vergoldeten Staubfäden bringen in einem solchen Bouquet eine hübsche Wirkung
hervor.
Färben der Uhrschrauben. Man benutzt dabei ein mit
Löchern verschiedener Größe versehenes Eisenblech (Fig. 23), welches durch
zwei daran sitzende starke Drähte getragen und mit dem positiven Pole verbunden
wird. Die Schrauben werden in die Löcher gesteckt, so daß ihre Köpfe auf dem Bleche
ruhen. Die stählernen Schrauben müssen gehärtet und sehr schwarz polirt werden, im
Gegensatz zu denen, welche man durch Anlassen blau macht, welche eine graue Politur verlangen.
Uhrschrauben, die galvanisch roth gefärbt sind, bringen einen sehr schönen Effect
hervor, und wenn der Kopf rund ist, bilden sie eine hübsche Nachahmung von Rubin;
ebenso verhält es sich mit einer Unruhe mit polirten Facetten.
Von den Ursachen der Veränderung der galvanischen Farben und
den Mitteln dagegen. Trockne Luft verändert die durch Bleisuperoxyd
hervorgebrachten Farben durchaus nicht; nicht so ist es mit feuchter Luft,
namentlich wenn sie Spuren von schwefliger Säure oder Schwefelwasserstoff enthält.
Deßhalb wird die Farbe der Uhrzeiger durch die Ausdünstung des Körpers verändert,
wenn das Uhrgehäuse nicht ganz dicht schließt. Der Verfasser beobachtete oft, daß
von zwei Paaren von Zeigern, die unter gleichen Umständen gefärbt waren, das eine
seine Farbe schon nach 8 Tagen gänzlich verändert hatte, während das andere Paar
nach Verlauf eines Jahres noch ganz unverändert war, und bemühte sich lange
vergebens, die Ursache davon zu finden, ist aber gegenwärtig überzeugt, daß die
schnelle Veränderung der Farbe davon herrührt, daß eine Spur Kali zurückblieb, unter
dessen Einfluß wieder Bleioxyd entsteht, welches sich mit dem Kali verbindet. Gegen
diese letztere Ursache des Verderbens der Farben kann man sich leicht dadurch
schützen, daß man den Gegenstand nach dem Färben mit siedendheißem Wasser wäscht, so
daß alles Kali entfernt wird, dann abwischt und auf einer erwärmten Eisenplatte
trocknet. Was die Veränderung der Farben durch die Einwirkung feuchter und mit
fremdartigen Stoffen behafteter Luft anbetrifft, so hat Becquerel empfohlen, die Gegenstände dadurch davor zu schützen, daß man
sie nach dem Färben mit einem Firniß überzieht. Dieser Firniß muß möglichst wenig
reducirend wirken, um das Bleisuperoxyd nicht zu zersetzen. Becquerel empfiehlt für diesen Zweck folgenden Firniß: In einen glasirten
Topf bringt man 1/2 Liter Leinöl, 4–8 Grm. präparirte Bleiglätte und 2 Grm.
Zinkvitriol, und erhitzt diese Mischung mäßig mehrere Stunden lang. Nachher
decantirt man den klaren Firniß von dem ungelösten, und vermischt ihn, wenn er zu
dick ist, mit Terpenthinöl, welches man vorher mit Bleioxyd gekocht hat, um alle
darin etwa enthaltene Säure wegzunehmen. Der Gegenstand wird mit dem so bereiteten
Firniß mittelst eines Pinsels ganz dünn überzogen, in gelinder Wärme getrocknet und
darauf noch ein zweites Mal überstrichen. Durch Anbringung dieses Firnisses
verlieren die Farben, wie Becquerel anführt, etwas von
ihrem Glanze und erscheinen nachher auch zum Theil von etwas anderer Nüance,
gewinnen aber an Haltbarkeit. Nach den Versuchen des Verfassers ist der Becquerel'sche Firniß nicht anwendbar, und bringt jeder
Firniß, mit welchem man die roth gefärbten Zeiger überzieht, die Wirkung hervor, daß die
rothe Farbe als Gelb erscheint. Nimmt man den Firniß wieder weg, so erscheint die
rothe Farbe wieder unverändert. Diese Wirkung des Firnisses beruht also nicht auf
einer Veränderung des Bleisuperoxyds, sondern darauf, daß die Dicke der auf dem
Metalltheile angebrachten Schicht, von welcher die Farbe abhängt, durch die
Anbringung des Firnisses verändert wird.
Tafeln