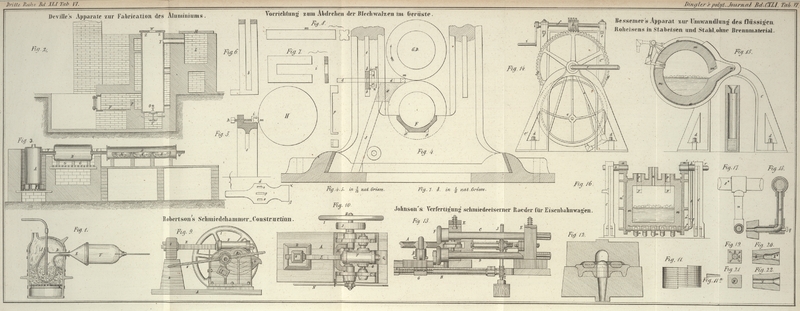| Titel: | Ueber die Fabrication des Natriums und des Aluminiums; von H. Sainte-Claire Deville. |
| Fundstelle: | Band 141, Jahrgang 1856, Nr. XCIX., S. 441 |
| Download: | XML |
XCIX.
Ueber die Fabrication des Natriums und des
Aluminiums; von H. Sainte-Claire
Deville.
(Schluß von S. 381 des vorhergehenden
Heftes.)
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Deville, über die Fabrication des Natriums und des
Aluminiums.
II. Fabrication des
Aluminiums.
Dieselbe zerfällt in die Darstellung des Chloraluminiums und in die Abscheidung des
Aluminiums aus demselben.
Darstellung des Chloraluminiums. – Das
Chloraluminium wird bekanntlich durch Einwirkung von trockenem Chlorgas auf ein glühendes Gemenge von
Thonerde und Kohle dargestellt. Um die Umstände bei der Bildung des Chloraluminiums
näher kennen zu lernen, stellte ich zuerst einen Versuch in kleinerem Maaßstabe an.
5 Kilogr. Thonerde, durch Glühen von eisenfreiem Ammoniakalaun dargestellt, wurden
mit 2 Kilogr. Kohlenpulver und etwas Oel zur teigartigen Masse gemischt und diese
stark geglüht. Die erhaltene kohlige Masse wurde in Stücke zerbrochen und in die
thönerne, 10 Liter fassende Retorte C, Fig. 1, gebracht. Diese
Retorte wurde dann in einen Ofen gestellt und zum Rothglühen erhitzt, während man
durch den Tubulus A einen Strom trockenes Chlorgas
hineinleitete. Anfangs entweicht aus dem Halse D viel
Wasserdampf, welchen die thonerdehaltige Kohle aus der Luft angezogen hat. Wenn das
Chloraluminium zu erscheinen beginnt, verbindet man mit dem Halse D einen porzellanenen Trichter E, indem man die Fuge durch Einstecken von Asbest und Lutiren mit einem
Gemenge von Töpferthon und Kuhhaaren dichtet. Mit der äußeren Mündung des Trichters
wird eine tubulirte Glocke F verbunden, indem man die
Fuge am Trichter ebenfalls lutirt. Das Chloraluminium verdichtet sich in diesem
Apparate und bleibt gänzlich in demselben zurück, wie stark auch der Chlorstrom seyn
mag; das Chlor wird während der ersten drei Viertel der Operation von der
thonerdehaltigen Kohle so gut absorbirt, daß das durch den Tubulus der Glocke
entweichende Kohlenoxydgas das Lackmus nicht bleicht und leicht angezündet werden
kann. Dieses Gas raucht jedoch stets ein wenig, wegen eines geringen Gehalts von
Chlorkiesel. Wenn die Glocke F sich gefüllt hat, trennt
man sie von dem Trichter, um das in ihr enthaltene cohärente und krystallisirte
Chloraluminium herauszunehmen, und ersetzt sie sofort durch eine andere. Auf drei
Mal entnahm ich der Glocke im Ganzen 10,15 Kilogr. Chloraluminum. In der Retorte C blieb etwa 1 Kilogr. kohlige Masse zurück, die zu
ungefähr einem Drittheil aus Thonerde bestand. Der Rückstand (welcher Alkalichlorid,
Chloraluminium-Kalium und Chlorcalcium enthielt) wurde ausgewaschen,
neuerdings mit Thonerde gemischt, und zu einer neuen Operation verwendet, die fast
11 Kilogr. Chloraluminium lieferte.
Um diesen Versuch in großem Maaßstab zu wiederholen, wendete ich ebenfalls Thonerde
an, die durch Calciniren von eisenfreiem Ammoniakalaun dargestellt war. Das
Calciniren geschah in dem früher beschriebenen, bei der Natriumfabrication benutzten
Flammofen in gußeisernen cylindrischen Töpfen wie man sie zur
Beinschwarz-Fabrication anwendet. Der bei starker Rothglühhitze calcinirte
Alaun wurde pulverisirt und mit Steinkohlentheer unter Zusatz von etwas
Holzkohlenpulver gemischt, welcher Zusatz aber unnütz ist, wenn man das Gemenge von
Theer und Thonerde etwas
flüssig macht, was auch bequemer ist. Den gut geschlagenen Teig bringt man in die
erwähnten Töpfe, verschließt dieselben sorgfältig mit ihrem Deckel und setzt sie in
den Flammofen. Wenn keine Theerdämpfe mehr erscheinen, nimmt man die Töpfe heraus
und verwendet die darin enthaltene kohlige Masse während sie noch ganz heiß ist.
Den Chlorstrom lieferte eine Batterie von acht großen steinzeugenen Flaschen (bombonnes), deren jede 45 Liter Salzsäure enthielt; man
beschickte davon vier alle 24 Stunden, während die vier übrigen sich abkühlten. Es
lieferten also stets nur vier Flaschen gleichzeitig Chlorgas. Dasselbe wurde
mittelst bleierner, äußerlich durch Wasser abgekühlter Röhren in eine bleierne
Flasche mit concentrirter Schwefelsäure geleitet und strömte dann durch eine große
Flasche mit Chlorcalcium, bevor es in die Retorte gelangte.
Die angewendete Retorte war eine thönerne Gasretorte von etwa 300 Litern Inhalt, die
man aber durch Abschneiden an einem Ende um 30–40 Centim. verkürzt hatte. Sie
wurde vertical in dem Ofen Fig. 2 angebracht. F ist die Feuerung; die Flamme gelangte über der Brücke
P weg in einen die Retorte umgebenden
schraubenförmigen Canal und entwich am obern Ende der Retorte seitlich in die Esse.
Am untern Ende hatte die Retorte eine quadratische Oeffnung X von 2 Decimetern Seite, die man durch eine mittelst einer Schraube V angedrückte Steinplatte verschließen konnte. Ein die
Ofenwand durchdringendes, bei O in die Retorte
eintretendes und daselbst mit einem Gemenge von Töpferthon und Kuhhaaren lutirtes
Porzellanrohr führte das Chlorgas bis in die Mitte der Schicht thonerdehaltigen
Kohle. Dieses Porzellanrohr war zum Schutze gegen die Flamme mit einem Tiegel
umgeben, dessen Boden herausgeschlagen wurde und welchen man überdieß mit einem
Gemenge von Thon und Sand gefüllt hatte. Am oberen Ende war die Retorte durch eine
feuerfeste Thonplatte Z geschlossen, welche eine
quadratische Oeffnung W von 10–12 Centim. Seite
hatte. Durch diese Oeffnung wurde das Gemenge von Thonerde und Kohle in die Retorte
geschüttet, in dem Maaße als es in derselben verschwand. Eine 30 Centim. unterhalb
der Platte Z angebrachte Oeffnung Y gestattete den Dämpfen den Ausgang, welche durch ein hier angebrachtes
thönernes Rohr in die Verdichtungskammer L
gelangten.
Diese Kammer L war viereckig, hatte etwa 1 Quadratmeter
Grundfläche und 1,20 Meter Höhe. Sie hatte eine mit dem Ofen gemeinschaftliche Wand
aus Ziegelsteinen, um sie auf einer ziemlich hohen Temperatur zu erhalten. Alle
anderen Wände müssen von sehr geringer Dicke aus Ziegeln aufgemauert seyn, und ihre
Grundfläche muß auf einem Gewölbe ruhen. Der Deckel M ist
beweglich und besteht aus einer oder mehreren glasirten Fayenceplatten. Das Innere
der Kammer wird mit solchen Platten ausgekleidet, deren Fugen man mit einem fetten
Thonkitt ausfüllt. Eine an der untern Seite der Kammer angebrachte Oeffnung, welche
2–3 Quadrat-Decimeter groß ist, setzt dieselbe mit beweglichen, im
Innern mit Blei ausgekleideten hölzernen Röhren in Verbindung, in denen sich etwas
fortgerissenes Chloraluminium ansetzte, und die mittelst einer engen Oeffnung in
eine gut ziehende Esse ausmündeten. In diesen Röhren waren Schieber angebracht, um
die Verbindung mit der Esse mehr oder weniger unterbrechen zu können.
Bevor man den Apparat in Gang setzt, müssen die verschiedenen Theile desselben
sorgfältig ausgetrocknet werden, namentlich die Kammer L, in welche man zu diesem Zwecke einen Ofen mit glühenden Kohlen stellt. Die
Retorte, welche man sehr langsam mit Steinkohlen erhitzt, wird am obern Ende ganz
offen gelassen, bis sie gut trocken ist, worauf man die frisch dargestellte und fast
noch glühende thonerhaltige Kohle einfüllt. Man legt dann die Platte Z auf und verstärkt das Feuer, bis die Retorte überall
dunkelrothglühend ist. Hierauf läßt man das Chlor eintreten, verschließt aber die
Oeffnung W nicht eher und läßt die Dämpfe nicht eher in
die Kammer L gelangen, als bis aus der Oeffnung bei Z sehr reichliche Dämpfe von Chloraluminium
heraustreten. Wenn die Operation gut geht, setzt sich fast alles Chloraluminium als
eine feste dichte Masse an dem Deckel M an. Ich erhielt
auf diese Weise einmal eine plattenförmige Masse von Chloraluminium, welche fast 50
Kilogr. wog, weniger als 1 Decimeter Dicke hatte und aus dicht zusammenliegenden
schwefelgelben Krystallen bestand. Wenn man annehmen kann, daß die Masse in der
Retorte bis auf eine Höhe von 30 Centim. erschöpft ist, öffnet man X, läßt die erschöpfte Masse herausfallen und bringt
durch W neue Masse in die Retorte. Das Heruntergehen der
Masse in der Retorte erfolgt ganz von selbst. Die Wände der Retorte werden sehr bald
angegriffen, wenn man nicht besorgt ist, die Masse um das Porzellanrohr herum
(welches das Chlor zuleitet) oft zu erneuern. Die Retorte. muß auch an der Stelle,
wo die Flamme in den sie umgebenden schraubenförmigen Canal eintritt, äußerlich
durch feuerfeste Steine geschützt werden.
Die Dimensionen dieses Apparates, welchen ich zu Javel anwandte, waren offenbar
schlecht berechnet, denn nach der Größe der Retorte, welche 200 Kilogr. Masse faßte,
hätten zur Chlorentwickelung gleichzeitig wenigstens 30 Flaschen, wie sie beim
Vorversuch benutzt wurden, angewendet werden müssen, um beiläufig 250 Kilogr.
Chloraluminium zu liefern, und dann wäre die Kammer L zu
klein gewesen. Bei gutem Gange entweicht übrigens mit dem Kohlenoxydgase hauptsächlich nur etwas
Chlorkiesel. Dieselbe Retorte läßt sich zwei Monate lang benutzen. In der Wand des
die Retorte umgebenden Canals kann man leicht verschließbare Oeffnungen anbringen,
um zu sehen, ob die Retorte irgendwo einen Riß hat, was sich durch eine blaue, die
Gegenwart des Chloraluminums charakterisirende Farbe der Flamme zu erkennen gibt.
Kleinere Risse kann man mit einem Gemenge von Wasserglas und Asbest verstopfen.
– Das Chloraluminum ist schlecht aufzubewahren und muß deßhalb bald
verbraucht werden.
Abscheidung des Aluminiums aus dem Chloraluminium.
– Der Apparat welchen ich hiezu in meinem Laboratorium zu Javel anwendete,
war sehr mangelhaft; ich theile aber dessen Beschreibung mit, weil er in der Fabrik
der Gebrüder Rousseau noch jetzt mit ziemlich günstigem
Erfolge angewendet wird und die Kenntniß desselben für die weitere Vervollkommnung
des Verfahrens nützlich ist.
Das rohe Chloraluminium, in den Cylinder A, Fig. 3,
gebracht und mittelst der Feuerung F erhitzt, verdampft
leicht und gelangt durch das Rohr Y in den Cylinder B, welcher 60–80 Kilogr. eiserne Drahtstifte
enthält und durch die Feuerung G zum dunkeln Rothglühen
erhitzt wird. Das Eisen hält das in dem Chloraluminium enthaltene Eisenchlorid
zurück, indem es dasselbe in das wenig flüchtige Eisenchlorür verwandelt;
deßgleichen hält es die durch die Einwirkung der Luftfeuchtigkeit auf das
Chloraluminium gebildete Salzsäure zurück; endlich auch den Chlorschwefel, mit
dessen Bestandtheilen es Eisenchlorür und Schwefeleisen bildet. Die dünnen Blättchen
von Eisenchlorür welche der Dampf mit fortreißt, setzen sich in dem weiten Rohre C ab. Der Chloraluminiumdampf gelangt aus C in den gußeisernen Cylinder D, in welchem drei nachenförmige gußeiserne Schalen N stehen, deren jede mit 500 Grm. Natrium beschickt wird. Das Rohr C wird auf einer Temperatur von 200–300°
C. erhalten, welche hinreicht um die Verdichtung des Chloraluminiums zu verhindern,
während bei derselben das Eisenchlorür keine merkliche Spannung hat. Der Cylinder
D wird so weit erhitzt, daß er an seiner unteren
Seite kaum dunkelrothglühend ist; die Reaction zwischen dem Chloraluminium und dem
Natrium ist so lebhaft, daß man oft genöthigt ist, das Feuer ganz wegzunehmen. Wenn
das Chloraluminium mit dem Natrium zusammentrifft, bildet sich Chlornatrium und es
wird Aluminium frei. Das Chlornatrium verbindet sich alsdann mit dem Ueberschuß des
Chloraluminiums zu dem bekannten Doppelsalz, welches flüchtig genug ist, um in die
nächste Schale zu verdampfen, wo das darin enthaltene Chloraluminium ebenfalls durch
das Natrium zersetzt wird. Die Reaction beginnt in einer Schale immer erst, nachdem sie in der
vorhergehenden beendigt ist; sie ist in sämmtlichen Schalen beendet, wenn man beim
Oeffnen des Deckels W wahrnimmt, daß das Natrium in der
letzten Schale gänzlich in eine warzenförmige schwarze Masse verwandelt ist, welche
von einer farblosen Flüssigkeit (dem Doppelsalz von Chloraluminium-Natrium)
umgeben ist. Man nimmt dann die Schalen heraus und ersetzt sie sofort durch andere.
Die herausgenommenen Schalen deckt man zu und läßt sie erkalten.
Den Inhalt der Schalen bringt man nachher in eiserne Töpfe oder thönerne Tiegel, die
im Natriumofen erhitzt werden, bis die Masse vollständig geschmolzen ist und das
Doppelsalz zu verdampfen beginnt. Meistens erfolgt die Reaction zwischen dem
Chloraluminium und dem Natrium in den Schalen nicht vollständig, weil das Natrium
zum Theil von dem entstandenen Chlornatrium umhüllt wird. Aber das am obern Theil
der Schalen befindliche Chloraluminium-Natrium reicht stets hin, um beim
Erhitzen der Masse in den Töpfen oder Tiegeln das darin noch vorhandene Natrium
ebenfalls in Chlornatrium umzuwandeln, so daß man in den Tiegeln zuletzt Aluminium
mit einem großen Ueberschuß von Chloraluminium hat, was für das Gelingen der
Operation unerläßlich ist.
Wenn die Töpfe oder Tiegel erkaltet sind, findet man in ihrem oberen Theile eine
Schicht fast reinen Chlornatriums, die man wegnimmt, und in dem untern Theile
Kügelchen von mehr oder weniger reinem Aluminium, die man durch Waschen mit Wasser
absondert. Unglücklicherweise wirkt aber dieses Wasser, indem es das Chloraluminium
des Flußmittels auflöst, sehr rasch zerstörend auf das Metall, so daß nur noch
diejenigen Aluminiumkügelchen übrig bleiben, welche größer als ein Stecknadelkopf
sind. Man sammelt diese, trocknet sie, bringt sie in einen thönernen Tiegel, erhitzt
denselben zum Rothglühen, und zerdrückt die Kügelchen, wenn sie zu schmelzen
beginnen, mittelst eines thönernen Spatels. Dabei vereinigen sie sich zu einer
geschmolzenen Masse, die man nun in eine Form ausgießt.
Sollte das Natrium in Folge mißlungener Darstellung Kohlentheilchen (Natronkohle)
enthalten, so muß man diese vor seiner Anwendung zur Aluminium-Fabrication
sehr sorgfältig auslesen, weil sich sonst cyansaure Salze oder Cyanide bilden
würden, welche sich in Berührung mit Wasser zersetzen, Amoniak erzeugen und auch
noch Aluminium zerstören. Man muß sich wohl hüten, Aluminium, welches überschüssiges
Natrium enthält, zusammenzuschmelzen, denn die Masse würde sich entzünden; solches
Aluminium muß mit etwas Chloraluminium-Natrium geschmolzen werden.
Nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren waren die Aluminiumbarren dargestellt,
welche ich in die Pariser Ausstellung gab; offenbar ist dasselbe sehr mangelhaft und
überdieß hatte ich, weil ich mit der Wirkung des Aluminiums auf Kupfer unbekannt
war, bei fast allen meinen Versuchen einen Cylinder D
und Schalen N von Kupfer angewendet, was zur Folge
hatte, daß das Aluminium eine erhebliche Menge Kupfer aufnahm, weßhalb es seine
Dehnbarkeit fast ganz verloren hatte, eine häßliche graue Farbe besaß und nach
einigen Monaten sich schwärzte durch Bildung von Kupferoxyd und Schwefelkupfer.Ich habe noch kein gutes Verfahren zum Reinigen des Aluminiums; den besten
Erfolg lieferte mir bis jetzt die Behandlung desselben in der Muffel, um die
fremden Metalle zu oxydiren. Hr. Peligot zeigte
mir Aluminiumkörner, welche er auf der Kapelle mit Blei abgetrieben hatte
und die sehr hämmerbar waren. Nur ein Aluminiumbarren, welcher kein Kupfer enthielt, hat sich ganz blank
erhalten. – Das Aluminium, welches ich Hrn. Regnault zur Bestimmung der specifischen Wärme dieses Metalles übergab,
war ebenfalls kupferhaltig.Nach Salvetat's Analyse im polytechn. Journal Bd. CXI. S. 76.
Tafeln