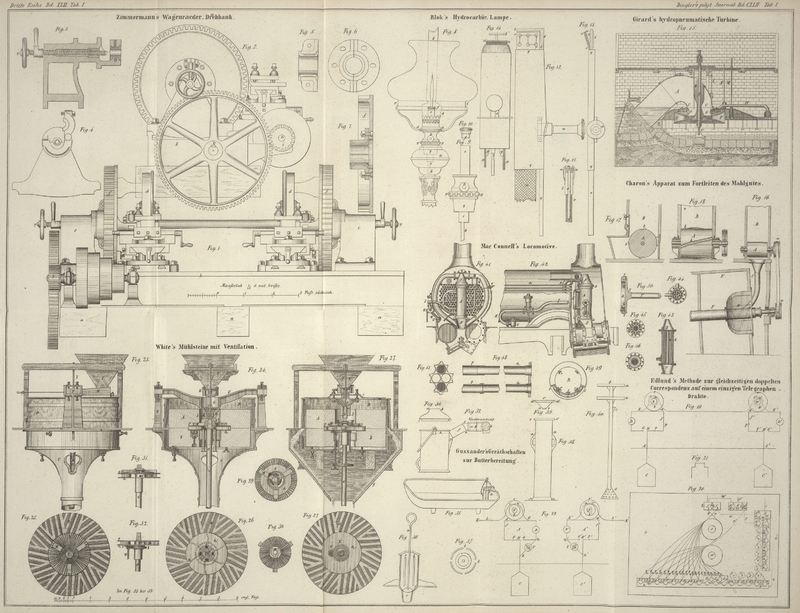| Titel: | Verbesserte Hydrocarbür- oder Photogen-Lampe; von dem Lampenfabrikanten B. C. Blok in Emden. |
| Fundstelle: | Band 142, Jahrgang 1856, Nr. VI., S. 19 |
| Download: | XML |
VI.
Verbesserte Hydrocarbür- oder
Photogen-Lampe; von dem Lampenfabrikanten B. C. Blok in Emden.
Patentirt für das Königreich Hannover am 20.
Novbr. 1855. – Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins, 1856, S.
130.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Blok's verbesserte Hydrocarbür- oder
Photogen-Lampe.
Von den bis jetzt allgemein gebräuchlichen Hydrocarbür-Lampen unterscheidet
sich diese Lampe, Fig. 8, durch folgende Umstände:
1) daß der gläserne Behälter a mittelst eines
eingeschliffenen gläsernen Stöpsels dicht zu verschließen ist; dieser Stöpsel
enthält in seiner Mitte ein unrundes Loch, in welchem der hindurchgehende Brenner
befestigt ist;
2) daß ein eingeschnürtes Zugglas b, b (wie bei Oellampen
gebräuchlich) angewendet und hiemit die sonst nöthige Blechkapsel über dem Brenner
erspart wird, so daß auch der unter dieser Kapsel entwickelte Antheil Licht zu Gute
kommt;
3) daß nicht nur bei Brennern mit hohlem Dochte, sondern auch bei jenen mit flachem
und mit vollrundem Dochte die an Oellampen gebräuchliche Zahnstangen-Winde
angebracht ist;
4) daß zum Aufsaugen der brennbaren Flüssigkeit ein eigener, beständig in der Lampe
verbleibender Saugdocht (Sauger) vorhanden ist, während der damit in Verbindung
gebrachte Brenndocht leicht eingesetzt und gewechselt werden kann.
5) daß der Kuppelrand c, c mittelst seines Ringes d, d lose ausgesetzt ist, daher entfernt werden kann,
und dann die Lampe bequemer gereinigt und geputzt wird.
Der Brenner zu einem vollen runden Dochte, wie er in Fig. 8 angezeigt
erscheint, ist nach größerem Maaßstabe in Fig. 9, 10 und 11 vorgestellt: –
Fig. 9
dessen äußere Ansicht; Fig. 10 der Brennerring;
Fig. 11
der Saugdocht nebst seinem Mechanismus.
l, m in Fig. 11 ist ein
cylindrisches Rohr von Weißblech, mit dem Saugdochte p
ausgefüllt, welcher mittelst kleiner Löcher am obern Ende m festgenäht ist, unten in p lang hervorragt.
Aeußerlich an l, m sind zwei Dochtfedern n, n und die Zahnstange o
angelöthet. Die ersteren halten den Brenndocht zwischen sich fest, wenn dieser in
die obere Oeffnung des Rohrs, unmittelbar auf den Saugdocht gestellt wird.
Die Vorrichtung Fig.
11 wird in dem Rohre e, Fig. 9, hinabgeschoben,
wobei die Zahnstange o in ihre Scheide k eintritt und mit dem Getrieb der Winde in Eingriff
kommt, dessen Drehknopf bei h angegeben ist; der
Saugdocht p hängt dann unten aus i herab und taucht in die Flüssigkeit des Behälters, in dessen Hals der
Conus q paßt. Oben auf e
steckt man den Brennerring f, Fig. 10, durch dessen
Oeffnung der Brenndocht so weit als nöthig hervortritt. Bei g, g ist ein Kranz von Löchern zum Eintritt der Zugluft.
Fig. 12 und
13 sind
zwei Ansichten eines Brenners zu flachem Dochte. In dem platten Rohre q, q und der damit verbundenen Scheide v geht die Zahnstange t der
Winde w auf und nieder, an deren oberem Ende der
Dochtträger festgelöthet ist. Dieser besteht aus zwei unten zusammen gelötheten,
einen Spitzen Winkel (V) bildenden, im freien Zustande
durch ihre eigene Elasticität auseinander klaffenden Blechplättchen r und 8, von welchen nur s
direct an der Zahnstange sitzt. Der Saugdocht u ist
oben, auf der innern Seite des andern Plättchens r
liegend, hieran festgenäht (wie die in Fig. 12 sichtbaren Löcher
und Stiche zu erkennen geben); er tritt dann durch eine große Oeffnung dieses
Plättchens heraus und geht frei in q hinab. Wenn, wie in
den Abbildungen, der Dochtträger r, s auf dem höchsten
Standpunkte, also fast gänzlich außerhalb q und offen
ist, so kann in seine Oeffnung zu dem Saugdochte u der
Brenndocht gelegt werden, welcher sich von selbst einklemmt und ins Innere von q folgt, sobald der Dochtträger beim Hinabbewegen sich
schließt.
Fig. 14
endlich zeigt den verbesserten Brenner zu hohlem Dochte. Der hohle Brenndocht wird
hier wie allgemein bei den Oellampen mittelst zweier breiten Dochtfedern auf dem
innern (beweglichen) Cylinder festgehalten; aber auf den innern Seiten dieser Federn
sind zwei flache Saugdochte angenäht, welche, zwischen der Wand des Außencylinders
und den schirmartigen, mit dem innern Cylinder verbundenen Wandsegmenten
y, y hinabreichend, bei x, x
heraushängen. Die Winde ist die gewöhnliche; unter dem Getriebe geht quer durch den
Cylinder eine Oeffnung z, mittelst welcher der innere
Luftzug seinen Eingang findet. a' ist der Brenndocht;
b' das bekannte über demselben angebrachte
Messingscheibchen, durch welches der innere Luftzug nach der Flamme hin abgelenkt
wird.
Tafeln