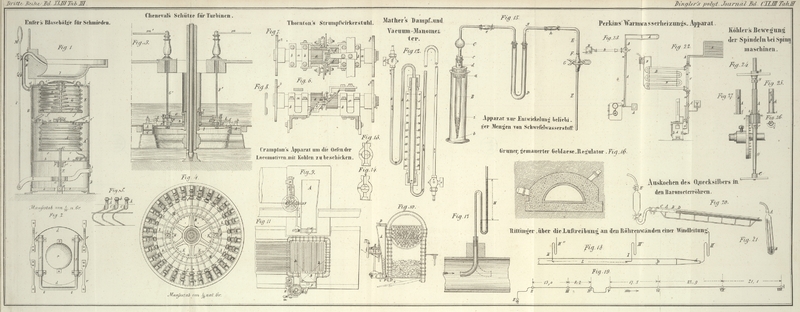| Titel: | Doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für Schmieden; von den Gebrüdern Enfer, Mechaniker zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. XXXIX., S. 174 |
| Download: | XML |
XXXIX.
Doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für
Schmieden; von den Gebrüdern Enfer, Mechaniker zu Paris.
Aus Armengaud's Génie industriel, Octbr. 1856, S.
180.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Enfer's doppelt und continuirlich wirkende Blasebälge für
Schmieden.
Die Gebrüder Enfer, welche sich seit Jahren mit der
Anfertigung von Gebläsen für Schmieden beschäftigen, ließen sich neuerlich einen
verbesserten Apparat dieser Art patentiren, den wir hier beschreiben wollen. Er
vereinigt Wohlfeilheit mit den wesentlichen Bedingungen einer ununterbrochenen
Speisung der Schmiedefeuer mit Wind.
Fig. 1 ist ein
Durchschnitt des Balges nach seiner Achse, aus welchem man alle Theile, aus denen er
besteht, erkennen kann.
Fig. 2 ist ein
Grundriß, das bewegliche Feuer als weggenommen gedacht.
Aus Fig. 1
ersieht man, daß dieses doppeltwirkende Gebläse mit darüber befindlichem Feuer, aus
einem cylindrischem Blasebalg A besteht, der an einer, anau dem Gehäuse B angebrachten Platte a befestigt ist.
In der Platte a sind zwei, durch die Ventile C, D verschlossene Oeffnungen angebracht; die erstere
C ist mit einem blechernen Mantel a' bedeckt, welcher sie von dem obern Theile des Balges
oder dem Windbehälter E absondert, während die zweite
diesen Raum mit dem eigentlichen Gebläse verbindet.
Der cylindrische Blasebalg A ist von dem untern Raum des
Mantels B durch die Platte b
getrennt, welche mit einem Ventil D' versehen ist.
Der Mantel B ist unten mit einer hölzernen Platte c verbunden, und diese mit vier eisernen Füßen versehen,
welche auf dem Boden stehen.
Auf dem Deckel d des Mantels ist das Schmiedefeuer
befestigt.
Ein Ventil E' setzt den Behälter, in welchem sich der
Balg A bewegt, mit dem Luftreservoir E in Verbindung. In diesem Reservoir ist eine Art Kolben
G angebracht, der fast dieselbe Form wie der
Blasebalg A hat, sich von demselben aber dadurch
unterscheidet, daß dieser stets zu sinken sucht, wozu er durch die gußeiserne Platte
e am untern Theil veranlaßt wird, während der Kolben
G durch eine conische Springfeder g gespannt wird, die einerseits an der Platte f und anderseits unter der sphärischen Kappe e' befestigt ist; letztere bedeckt die Oeffnung durch
welche die Feder g geht.
Eine Oeffnung o, an der Seite des Luftbehälters E, stellt die Verbindung zwischen diesem und der Form
des Schmiedefeuers, mittelst der gekrümmten Röhre H her,
welche durch eine Flantsche mit dem Mantel verbunden ist.
Der Theil der Form in welchen die Luft einströmt, ist so angeordnet – wie man
deutlich aus Fig.
4 ersieht – daß die Schlacken, welche sich im Herde bilden, nicht
in das Innere des Gebläses gelangen können.
In der Mitte der gußeisernen Platte c, c ist eine
schmiedeiserne Mutterschraube e' angebracht, welche das
mit einem Gewinde versehene Ende einer eisernen Stange K
aufnimmt, die unten in ein Quadrat k endigt, an welchem
zwei Klauen d' angebracht sind. Diese sind mit dem Hebel
L verbunden, der sich um einen Nagel, in dem an dem
Mantel befestigten Bügel l dreht.
Das andere Ende des Hebels L ist an der Stange P befestigt, welche die Verbindung mit dem Schwengel M herstellt; letzterer dreht sich um den Nagel N, der am Schmiedefeuer I
befestigt ist.
Die Stange K geht durch die Platte b mittelst einer Büchse p, p', welche durch
eine Leder- oder Kautschuk-Liederung den Durchgang der Luft neben der
Stange verhindert.
Die Wirkung der gußeisernen Platte e kann man durch
diejenige einer conischen Springfeder ersetzen, welche unten mit den Klauen d' und oben mit der Platte b
verbunden würde.
Diese kleine tragbare Schmiedesse wird folgendermaßen betrieben:
Indem man auf den Schwengel mittelst des Griffes M
einwirkt, wird der Hebel L in Bewegung gesetzt und
dieser überträgt mittelst der Klauen d' die Bewegung auf
die Stange K und folglich auf den eigentlichen Blasebalg
A. Bei dieser aufsteigenden Bewegung des Balges
öffnet sich das Ventil D' und läßt Luft in den Raum A' gelangen, während die im Innern des Balges A enthaltene Luft in Folge der Zusammenpressung des Behälters E entweicht, indem sich das Ventil E' öffnet. Wenn dagegen der Hebel L niedergeht, so schließt sich das Ventil D,
das Ventil C öffnet sich und läßt äußere Luft
eindringen, welche durch die Oeffnung c' ins Innere des
Blasebalgs A gelangt.
Während dieser Zeit und in Folge derselben niedergehenden Bewegung schließt sich das
Ventil D' und die in dem Raum A' enthaltene Luft entweicht durch das Ventil D in den Behälter E. Man sieht daher, daß bei
jeder Bewegung des Hebels L, sey es aufwärts oder
abwärts, Luft in den Behälter E gelangt.
Der Raum dieses Behälters ist mit der Oeffnung o
verbunden, welche die Communication mit der Form der Art herstellt, daß aus
letzterer weniger Luft ausströmen kann, als sie empfängt. Daraus folgt, daß die
Luft, welche unter die Platte f tritt, dem Blasebalg G eine aufsteigende Bewegung ertheilt, die den Windstrom
regulirt und ihn zu einem continuirlichen macht. Der Blasebalg ist also wirklich ein
doppelt und ununterbrochen wirkender.
Tafeln