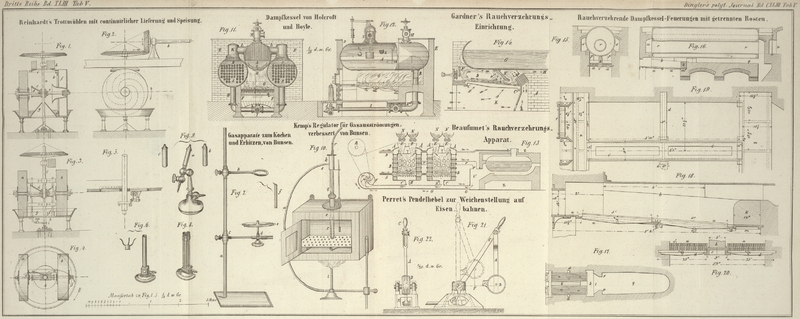| Titel: | Kemp's Regulator zur Erzielung constanter Temperaturen mittelst Leuchtgas, verbessert von Bunsen. |
| Fundstelle: | Band 143, Jahrgang 1857, Nr. LXXXIII., S. 342 |
| Download: | XML |
LXXXIII.
Kemp's Regulator zur
Erzielung constanter Temperaturen mittelst Leuchtgas, verbessert von Bunsen.
Mit einer Abbildung auf Tab. V.
Regulator zur Erzielung constanter Temperaturen mittelst
Leuchtgas.
Dieser RegulatorKemp's Regulator wurde
im polytechn. Journal, 1850, Bd. CXVII S. 352 beschrieben., welcher in Fig. 10 abgebildet ist, hat den Zweck, bei Apparaten zum Trocknen,
überhaupt bei allen Vorrichtungen, welche mit Leuchtgas erwärmt werden, eine
beliebige, genau gleichmäßige Temperatur hervorzubringen.
Er besteht aus einem unten zugeschmolzenen Glascylinder c, in dessen unterem Theil sich ein Luftgefäß befindet, welches unten offen
und durch Quecksilber, mit welchem der Cylinder bis q
gefüllt ist, abgeschlossen wird.
In diesen Cylinder taucht oben eine mit einer seitlichen Röhre s versehene weite Glasröhre in das Quecksilber ein; mit dieser oben fest
verbunden ist die engere Röhre r, welche unten einen
langen schmalen Spalt, oben eine feine Seitenöffnung hat und mit einer Mutter auf und ab bewegt werden
kann.
Der Gang des Apparates ist nun folgender: das Gas tritt mittelst eines
Kautschukschlauches aus der Hauptröhre in die bewegliche Röhre r, von da durch den schmalen Spalt bei q in die weite Glasröhre und durch die Seitenröhre s zu einem zweiten Stück Kautschukschlauch a, welcher mit der Lampe l
verbunden ist.
Befindet sich das Quecksilbergefäß des Regulators in dem Raume eines
Lufttrockenapparates, dessen Temperatur constant erhalten werden soll, so erleidet
das Luftgefäß in dem Instrument dieselbe Ausdehnung, wie die Luft in dem
Trockenapparat. Mit steigender Temperatur steigt daher das Quecksilberniveau in dem
Quecksilbergefäß und verkürzt den Spalt bei q im
Zuflußrohr, so daß der Gaszufluß zur Lampe abnimmt. Bei eintretender
Temperatur-Erniedrigung tritt das umgekehrte ein, so daß das
Quecksilberniveau sinkt, der Spalt des Zuflußrohres sich vergrößert und mithin die
Temperatur steigt. Durch diese Regulirung wird eine constante Temperatur in dem
Trockenapparat hergestellt, die man beliebig hoch oder niedrig wählen kann, je
nachdem man das Zuflußrohr r mittelst der Mutter über
das Quecksilberniveau erhebt oder einsenkt. Wenn die Lampe vor Luftzug geschützt
ist, kann man auf diese Weise Temperaturen von 40 bis 250° C. und darüber bis
auf 2 oder 3 Grade constant erhalten.
Bei schnell zunehmender Temperatur kann der schmale Spalt ganz verschlossen werden,
und es würde dann die Flamme erlöschen, wenn nicht durch die feine Seitenöffnung der
Röhre so viel Gas ausströmen könnte, um die Flamme brennend zu erhalten.
Solche Regulatoren können von mir zum Preise von 3 fl. bezogen werden.
P. Desaga,
Universitäts-Mechanikus in Heidelberg.
Tafeln