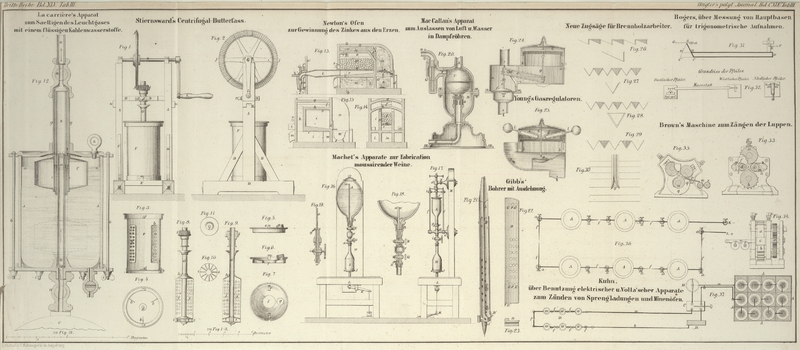| Titel: | Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des Leuchtgases mit einem flüssigen Kohlenwasserstoffe, welcher dessen Leuchtkraft vergrößern kann; Bericht von Hrn. J. Lissajous. |
| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. XLVII., S. 208 |
| Download: | XML |
XLVII.
Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des
Leuchtgases mit einem flüssigen Kohlenwasserstoffe, welcher dessen Leuchtkraft
vergrößern kann; Bericht von Hrn. J.
Lissajous.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, Mai 1857, S. 271.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Ueber Lacarrière's Apparat zum Sättigen des Leuchtgases mit
einem flüssigen Kohlenwasserstoff.
Es wurde schon öfters vorgeschlagen, das Steinkohlengas durch ein weniger
kohlenstoffreiches Gas zu ersehen, ja sogar durch mehr oder weniger reines
Wasserstoffgas; nur mußte man letzterm, um ihm eine hinreichende Leuchtkraft zu
ertheilen, eine flüchtige und kohlenstoffreiche Substanz im erforderlichen
Verhältniß beimischen, um der Flamme soviel Kohle zu liefern, als nothwendig ist um
sie glänzend zu machen, ohne daß sie rauchend wird. Die bisher zur Lösung dieser
Aufgabe angewendeten verschiedenen Verfahrungsarten hatten zum Zweck, das Gas in der
Anstalt selbst zu sättigen. Bei diesem System war jedoch zu befürchten, daß das Gas
dem Consumenten nicht mit dem normalen Verhältniß von Kohlenwasserstoff-Dampf
zukommt, und daß es überhaupt in verschiedenen Entfernungen von der Gasanstalt nicht
den gleichen Sättigungsgrad besitzt. Hr. Lacarrière entschloß sich daher, das Gas bei dem Consumenten zu
sättigen, mittelst eines Apparats, in welchen dasselbe gelangt, nachdem es vorher
die Gasuhr passirt hat.
Der Sättigungsapparat des Hrn. Lacarrière besteht
aus einem metallenen Cylinder, welcher den flüssigen Kohlenwasserstoff enthält. Das
Gas dringt in den Apparat durch ein Rohr, welches in der Achse des Cylinders
angebracht ist und über das Niveau der Flüssigkeit hinaufreicht; über dieses Rohr
ist ein zweites Rohr gesteckt, welches an seinem obern Theil geschlossen und in der
Nähe seines untern Endes auf seinem Umkreis mit mehreren Reihen von Löchern versehen ist. Ein
ringförmiger hohler Schwimmer von Metall umgibt die Basis der Röhre und erhält sie
in konstantem Grade bezüglich des Flüssigkeits-Niveau's eingesenkt. Das Gas
zieht also durch die centrale Röhre in den Apparat, gelangt in dem Raum zwischen
dieser Röhre und der sie umgebenden beweglichen Röhre wieder abwärts, dringt durch
die Flüssigkeit in sehr kleinen Blasen, zieht dann in dem Raum zwischen dem
ringförmigen Schwimmer und der beweglichen Röhre wieder in die Höhe, und entweicht
durch ein weites Rohr, welches auf dem obern Deckel des Sättigungsapparates
angebracht ist, zu dem Brenner.
Nach dem Urtheil des Ausschusses der Société
d'Encouragement in dessen Namen ich berichte, bewirkt dieser höchst
einfache und sinnreich construirte Apparat die Sättigung des Gases auf eine leichte,
bequeme und wahrhaft praktische Weise. Seine Wirksamkeit bleibt sich gleich, welche
Flüssigkeitsmenge im Cylinder enthalten seyn mag; ferner verhindert die
außerordentliche Zertheilung der Blasen jede Unterbrechung im Ausströmen des Gases,
daher dessen Durchgang durch die Flüssigkeit keine Schwankungen der Flamme
hervorbringen kann, welche für das Auge ermüdend wären; da endlich die flüssige
Schicht, durch welche das Gas aufsteigen muß, nur 5 Millimeter Höhe hat, so
vergrößert sie den Druck nicht in einer Weise, welche das Ausströmen des Gases
merklich behindern könnte.
Für diesen Apparat mußte nun ein flüssiger Kohlenwasserstoff gewählt werden, welcher
bei hinreichendem Kohlenstoffgehalt einen gewissen Grad von Flüchtigkeit besitzt,
ferner eine so constante Zusammensetzung hat, daß er immer dieselben Resultate gibt,
endlich zu einem so niedrigen Preise bezogen werden kann, daß er den Konsumenten
nicht nur für die Ankaufs- und Reparaturkosten des Apparates entschädigt,
sondern ihm auch noch einen Gewinn verschafft. Einen Theil dieser Bedingungen
vereinigt das Gemisch von Kohlenwasserstoffen, welches unter der Benennung Benzin
von Collas (benzine
Collas) verkauft wird. Wenn diese Flüssigkeit im
Apparate beiläufig im Verhältniß von 40 Grammen per
Kubikmeter Gas consumirt wird, so erzeugt sie bei gleichem Gasverbrauch eine
Lichtmenge = 170, während das ungesättigte Gas eine solche = 100 liefert. Das
gesättigte Gas, an freier Luft in einem Brenner mit platter Flamme verbrannt,
liefert ein glänzendes und so zu sagen dichteres Licht als das ungesättigte Gas;
dieses Licht ist auch etwas mehr gelb, aber ohne Spur von Rauch und ohne üblen
Geruch. Bei Anwendung des mit einem Zugglase versehenen kreisförmigen Brenners ist
der Vortheil geringer, wenn man der Flamme eine etwas größere Höhe gibt als die mittlere, welche die
Flammen des gewöhnlichen Gasbrenners erreichen müssen; verkleinert man aber die
Flamme des Benzinbrenners auf die Dimension welche das schönste Licht gibt, so zeigt
er wieder dieselbe Ueberlegenheit gegen den gewöhnlichen, auf denselben Verbrauch
reducirten Gasbrenner.
Diese Vortheile wurden nicht merklich modificirt, als man das Gas ein Bleirohr von 31
Meter Länge mit 19 Windungen und 9 Knieen durchlaufen ließ; dasselbe war der Fall,
als man den Sättigungsapparat mit einer Kältemischung umgab, welche die Temperatur
des Benzins auf nahezu 0° erniedrigte.
Diese Resultate wurden durch zahlreiche, in Gegenwart der Ausschußmitglieder
angestellte Versuche bestätigt.
Die Ersparniß, welche sich mit dem Apparat bei seiner industriellen Anwendung
erzielen läßt, kann noch nicht festgestellt werden. Wenn der Preis des Benzins in
Folge größeren Absatzes auf 2 Fr. das Kilogr. herabgehen könnte, so erhielte man mit
1 Kubikmeter Gas, welcher 30 Centimes kostet, und 40 Grm. Benzin, welche 8 Cent.
kosten, dieselbe Lichtmenge wie mit 1 6/10 Kubikmet. Gas, welche 48 Cent. kosten;
man hätte also für 38 Cent. das Licht, welches man jetzt mit 48 Cent. bezahlt, was
eine Ersparniß von fast 28 Proc. betrüge. Diese Ersparniß würde noch größer, wenn
sich das Benzin wohlfeiler beziehen ließe oder durch einen wohlfeileren flüssigen
Kohlenwasserstoff ersetzt werden könnte.
Beschreibung des Apparates.
Fig. 12 ist
ein senkrechter Durchschnitt nach der Achse des Apparates.
A cylindrischer Behälter, welcher den flüssigen
Kohlenwasserstoff enthält, dessen Spiegel mit n, n
bezeichnet ist.
b sind Bolzen mit langem Schaft, um mittelst Schrauben
c; den obern und untern Deckel des Behälters
befestigen zu können.
B Röhre, welche das Gas in den Apparat führt; sie ist
auf den Boden des Behälters A geschraubt, und zwar in
ein vorspringendes Oehr desselben.
C Gasuhr.
D Hahn zum Zulassen des Gases; er ist einerseits an den
untern Deckel des Behälters A geschraubt, und
andererseits mit der Gasuhr C durch einen Tubulus
verbunden.
E Röhre von größerem Durchmesser als die Röhre B, über welche sie greift. Sie ist am obern Theil
geschlossen, und ihre untere Oeffnung communicirt mit der Flüssigkeit des Behälters
A, in welche sie stets in gleichem Betrage
(bezüglich des Spiegels) eintaucht, in Folge des Schwimmers
F, der sie zu halten hat. – Die Oberfläche der
Röhre E, welche in die Flüssigkeit taucht, ist mit
kleinen Löchern a versehen.
F hohler Cylinder von Metall, durch zwei sphärische
Kappen geschlossen, welcher als Schwimmer dient; durch seine Achse geht die Röhre
E, welche mit ihm mittelst einer cylindrischen Hülle
e von größerem Durchmesser verbunden ist.
e cylindrische Hülle, einerseits mit dem Schwimmer F verbunden, und andererseits mit der Röhre E, welche durch sie geht. Der untere Boden dieser Hülle
hat mehrere kleine Oeffnungen; deßgleichen ihr oberer Boden.
g Hülle der Röhre E; sie ist
auf den Deckel des Cylinders A geschraubt.
H Leitungsröhre, von welcher aus das Gas sich
vertheilt.
R Vertheilungshahn, welcher die in seine Büchse
eingeschraubten Röhren g und H verbindet.
S Schraubenpfropf, welcher die Oeffnung verschließt,
durch die man den Behälter A füllt.
T Entleerungshahn, um aus dem Behälter A den etwa darin gebildeten Niederschlag abziehen zu
können.
Behandlung des Apparats. – Angenommen, der Hahn
D sey geschlossen und der Behälter A bis n, n gefüllt, so muß
die Flüssigkeit, weil sie sowohl in die Röhre E durch
deren untere offene Mündung, als in das jene umgebende Rohr e durch die an dessen Basis angebrachten Oeffnungen dringen konnte, in
beiden auf dasselbe Niveau wie im Behälter A
steigen.
Oeffnet man nun den Hahn D, so wird das von der Uhr C gelieferte Gas durch die Röhre B aufsteigen, in die Röhre E dringen und
dieselbe anfüllen. So weit war sein Gang nur ein aufsteigender; da es aber am obern
Theil der Röhre E nicht entweichen kann, so wird es in
Folge seiner Spannkraft bald das Niveau der Flüssigkeit in dieser Röhre
niederdrücken und dieselbe hinabtreiben, bis es an den nun entblößten Oeffnungen a anlangt, durch welche es sich in das Rohr e begibt, deren Niveau sich nicht verändert hat.
Daselbst dringt es durch die Flüssigkeit, sättigt sich mit derselben, steigt
neuerdings in die Höhe, tritt durch die am obern Theil des Rohres e angebrachten Oeffnungen aus und zieht in die Röhre
(Hülle) g, um sich in die Leitung H zu begeben, welche ihm der Hahn R öffnet.
– Durch die Pfeile ist der Gang, welchen das Gas nach seinem Austritt aus der
Gasuhr befolgt, leicht ersichtlich.
In dem Maaße als dem Apparat Gas zuströmt, sinkt das Niveau der Flüssigkeit und
gleichzeitig der Schwimmer, wobei er der Röhre B
gestattet fortwährend in gleichem Betrage (unter dem Flüssigkeits-Niveau)
eingetaucht zu bleiben.
Die Stellung des Schwimmers, nachdem er am Ende seines Laufes anlangte, ist in der
Abbildung durch punktirte Striche angezeigt.
Tafeln