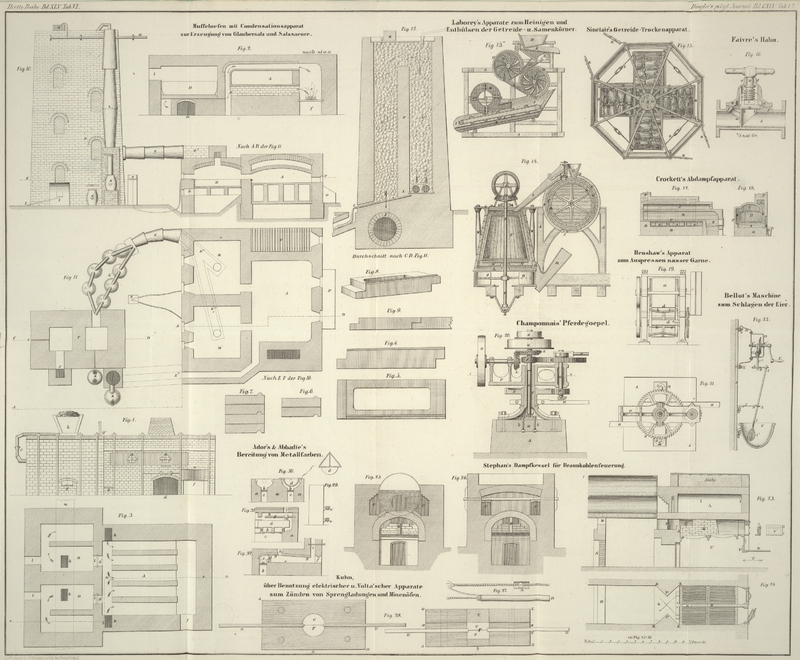| Titel: | Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die Porzellanmalerei etc.; von Leopold Ador und Ed. Abbadie in Paris. |
| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. CVII., S. 448 |
| Download: | XML |
CVII.
Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die
Porzellanmalerei etc.; von Leopold
Ador und Ed. Abbadie in Paris.
Aus dem London Journal of arts, Juli 1857, S.
24.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Ador's Darstellung zinkhaltiger Metallfarben für die
Porzellanmalerei etc.
Die Genannten stellen nach dem ihnen am 11. October
1856 in England patentirten Verfahren durch Glühen von schwefelsaurem
Zinkoxyd mit gewissen anderen Metallsalzen verschiedene Farben dar, welche
einerseits der Gesundheit nicht schädlich, andererseits dauerhaft und wohlfeil sind.
Bei der Zersetzung des schwefelsauren Zinkoxyds mittelst der Hitze in Oefen oder in
Retorten, wobei sich einfach-gewässerte Schwefelsäure entbindet, bleibt
Zinkoxyd zurück, welches verbunden mit anderen Metalloxyden, die
verschiedenartigsten Farben erzeugt.
Das zu verwendende schwefelsaure Zinkoxyd wird folgendermaßen bereitet: Man löst
metallisches Zink in Schwefelsäure von 18–20° Baumé auf; nachdem die Flüssigkeit
vollkommen gesättigt (neutral) ist, läßt man sie einige Zeit stehen, um sie in
klarem Zustande abgießen zu können; sie sollte nun 36–38° Baumé
zeigen. Hierauf wird sie in bleiernen Kesseln über freiem Feuer zur Teigconsistenz
abgedampft, indem man beständig umrührt, bis der Kessel vom Feuer abgehoben wird,
damit der Boden desselben nicht schmelzen kann. Das so verdickte schwefelsaure
Zinkoxyd wird auf Zink- oder Bleitafeln herausgeschafft, um auf denselben zu
erkalten, indem man es mit einem Holzspatel so viel als möglich ausbreitet oder
zertheilt.
Fig. 29 ist
ein Steinzeuggefäß (von beiläufig 75 Gallons Inhalt), worin die Zinkstücke in der
Schwefelsäure bis zu deren Sättigung aufgelöst werden.
Fig. 30 ist
der Querdurchschnitt des Ofens, welcher die bleiernen Kessel zum Abdampfen der
Zinklösung enthält. a das Mauerwerk; b die Feuerstellen; c der
Aschenraum; d die bleiernen Kessel worin das flüssige
schwefelsaure Zink abgedampft wird, bis es die Teigconsistenz erlangt hat.
Gelb. Sogenanntes Römisch-Gelb erhält man durch
Glühen des schwefelsauren Zinkoxyds allein, in den unten beschriebenen Retorten oder
Oefen.
Chamois oder Ledergelb erhält man durch Glühen des
Zinksalzes mit Eisenvitriol; 100 Theile Zinksalz als Auflösung werden mit 1 1/2 bis
2 1/2 Theilen Eisenvitriollösung von 28 bis 30° Baumé gemischt.
Goldgelb in verschiedenen Tönen erhält man, indem man 100
Theilen Zinksalz als Auflösung 2 1/2 Theile oder mehr einer Lösung salpetersauren
Mangans von 12 bis 14° Baumé beimischt.
Grün, sogenanntes Scheele'sches, erhält man durch Mischen von 100 Theilen Zinksalz als Auflösung
mit 2 1/2 Thln. oder mehr salpetersaurem Kobaltoxyd von 20° Baumé.
Grau erhält man durch Mischen von 100 Theilen Zinksalz
als Auflösung mit 2 1/2 Thln. oder mehr einer Kupfervitriollösung von 20°
Baumé.
Gelbgrün liefert eine Mischung von 100 Thln. Zinksalz als
Auflösung mit 2 1/2 Thln. einer Lösung von salpetersaurem Nickeloxyd von 15 bis
16° Baumé, nebst einigen Tropfen einer gesättigten Lösung von
salpetersaurem Silberoxyd.
Bronze erhält man, wenn man 100 Thle. Zinksalz als Lösung
vermischt: 1) mit 3 Thln. einer Lösung salpetersauren Nickeloxyds von 15 bis
16° Baumé; 2) mit 3 Thln. einer Lösung salpetersauren Kobaltoxyds von
derselben Stärke; und 3) mit 1 bis 1 1/2 Thln. einer Lösung salpetersauren Kupferoxyds
derselben Stärke. Dunkle Bronze erhält man durch längeres Glühen dieser
Mischung.
Rosenroth erhält man durch Mischen von 100 Thln. Zinksalz
als Auflösung mit 2 bis 3 Thln. Lösung von salpetersaurem Eisen von 20 bis
25° Baumé. Setzt man mehr von dem Eisensalz zu, so erhält man
dunkleres Rosa.
Weiß wird erhalten, indem man ganz reines, namentlich
eisenfreies schwefelsaures Zinkoxyd für sich allein glüht. Hierbei müssen auch
vollkommen reine Apparate angewendet werden; anstatt das teigförmige schwefelsaure
Zinkoxyd auf Blei- oder Zinktafeln zu trocknen, läßt man es zu diesem Zweck
in Steinzeuggefäße auslaufen.
Das Glühen geschieht entweder in thönernen Retorten oder auf dem Herde eines
Flammofens, nachdem man die Mischung der Metallsalze vorher zur Teigconsistenz
abgedampft hat, bei allmählich verstärkter Hitze. Es muß je nach der angewendeten
Mischung und der beabsichtigten Farbe mehr oder weniger lange dauern, und bei mehr
oder weniger starker Hitze geschehen. In Retorten dauert es im Allgemeinen 4 bis 8
Stunden, im Flammofen halb so lange. Sobald die gewünschte Farbe erzielt ist, muß
man das Product aus dem Ofen oder der Retorte herausziehen.
Retorten. – Fig. 31 ist ein
Längendurchschnitt des Retortenofens, a ist das
Mauerwerk; b Feuerstelle mit eisernen Rosten; c Aschenraum; d Retorte von
feuerfestem Thon, welche von glühenden Kohlen vollständig umgeben ist; e Träger von feuerfestem Thon, welche die Retorte an
mehreren Stellen unterstützen; g Platte von feuerfestem
Thon, welche die den obern Theil der Retorte umgebenden Kohlen an ihrem Platz erhält
und zugleich als Scheider zwischen der Feuerstelle und dem Canal h dient, durch welchen letztern die Verbrennungsproducte
entweichen, um in die Esse i abzuziehen. Im Mauerwerk
der Feuerstelle sind Zugöffnungen angebracht, um die Schüreisen einführen zu können,
mittelst deren das Brennmaterial gestochert, in seiner Lage um die Retorte herum
erhalten und auch die Schlacke entfernt wird. k ist ein
Rohr zum Entweichen des Gases aus der Retorte.
Flammofen. – Fig. 32 ist ein
Längendurchschnitt desselben. a Feuerstelle; b Aschenraum; c Feuerbrücke
von Ziegeln; d möglichst enges Gitter von Platindraht
oder Amianth, um von der Feuerstelle entweichende Kohlentheilchen und Flugasche
zurückzuhalten. e ist die Sohle oder der Herd des Ofens;
f eine Oeffnung desselben, um die Materialien
herauszuziehen; i die Esse, durch welche die gasförmigen
Producte entweichen;
j die Oeffnung, durch welche das Brennmaterial
eingebracht wird; m der Dämpfer der Esse. Vor der
Oeffnung f des Ofens wird eine auf ihrem Gerüst
bewegliche horizontale eiserne Walze angebracht, auf welcher sich das Instrument zum
Herausziehen des Products rollt.
Tafeln