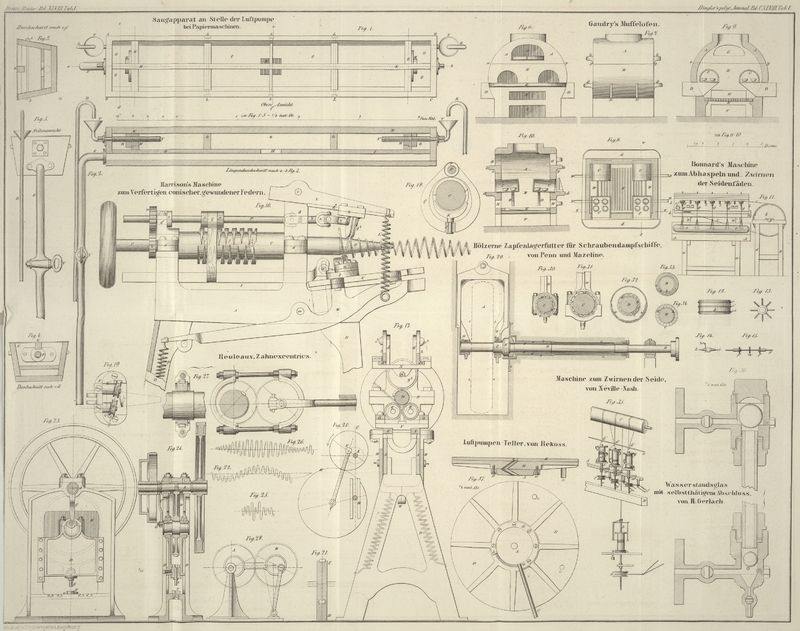| Titel: | Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln der Cocons, von Hrn. Bonnard in Lyon. |
| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. VIII., S. 30 |
| Download: | XML |
VIII.
Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln
der Cocons, von Hrn. Bonnard
in Lyon.
Aus Armengaud's Génie industriel, Decbr. 1857, S.
294.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Bonnard's Spinnen und Zwirnen der Tramseide beim Abhaspeln der
Cocons.
Die hier zu beschreibende Maschine hat den Zweck das Abhaspeln der Cocons und das
Zwirnen der Seidenfäden zu bewirken; sie ist dazu eingerichtet, die Fäden sogleich
als Einschlagseide zu liefern, welche sofort gefärbt werden kann; man vermeidet
folglich die Kosten für das sogenannte Spinnen der rohen Seide, für das Zwirnen
(Doubliren) und das Mouliniren, folglich den bei diesen verschiedenen Operationen
stattfindenden Abgang.
Diese Maschine nimmt in Folge ihrer Einrichtung nur einen beschränkten Raum ein. Für
die Hasplerin ist sie bequemer, weil dieselbe weder durch die Feuchtigkeit, noch
durch den Schmutz, den solche Apparate gewöhnlich hervorbringen, leidet, ferner sich
gar nicht um die Feuerung zu bekümmern braucht, da die Dampfmaschine nicht nur die
Becken, in denen die Cocons im Wasser liegen, erwärmt, sondern auch die
verschiedenen Organe bewegt, so daß das Drehen einer Handkurbel wegfällt. Die Arbeit
kann auf diese Weise weit sorgfältiger ausgeführt werden.
Die verschiedenen Anordnungen des Mechanismus sind in den Fig. 11, 12, 13, 14 und 15 dargestellt.
Fig. 11 ist
eine Gesammt- und perspectivische Ansicht von einem Theile der Maschine.
Fig. 12 ist
der Grundriß einer Treibrolle mit Kettenrädern.
Fig. 13, 14 und 15 sind
Details der verschiedenen, zur Vereinigung der Fäden dienenden Theile.
Die Maschine besteht aus einer Platte A, welche auf den
Füßen a aufliegt. Auf dieser Platte ist mittelst Füßen
a', a', die in Falzen verschiebbar sind, eine Platte
h angebracht, welche folglich in einer für die
Arbeit zweckmäßigen Höhe befestigt werden kann. Auf letzterer Platte sind zwei
senkrechte Ränder von ungefähr 24 Centimeter Höhe befestigt, wodurch eine Art Kasten
gebildet wird, der durch eiserne Leisten oder Winkel befestigt ist. Die so
angeordneten Platten sind mit sich entsprechenden Löchern versehen, deren Anzahl
derjenigen der anzuwendenden Spindeln g, g entspricht.
Jede dieser Spindeln ist mit einem hölzernen Getriebe m
versehen, ferner mit zwei anderen Getrieben f, welche
lose auf derselben Spindel sitzen. Auf diesen drei Getrieben sind drei
Vaucanson'sche Ketten angebracht, die andererseits über drei verschieden verzahnte
Räder laufen, welche auf einem Cylinder b angebracht
sind, der in dem Lager d lauft. Bei dieser Einrichtung
ist es das von der Vaucanson'schen Kette in Betrieb gesetzte Getriebe m, welches der Spindel die zum Abwickeln der Cocons
erforderliche Bewegung ertheilt; die beiden andern Getriebe bewirken das Zwirnen. Um
die Ketten gehörig fest auf den Getrieben zu erhalten, sind Führer l, l zwischen letzteren angebracht.
Ein Becken e ist auf der Platte A angebracht und mit Wasser gefüllt, welches durch Dämpfe aus dem Kessel
der Betriebs-Dampfmaschine mittelst eines Schlangenrohrs erwärmt wird. In
diesem Behälter befinden sich die Cocons. Alle Bewegungen werden durch die
Dampfmaschine veranlaßt.
Die Getriebe f haben einen Ansatz, auf welchem die
Häspel, Fig.
13, von gewöhnlicher Form angebracht werden. Vor denselben Getrieben
werden die Theile angebracht, welche die Seide auf die Häspel schaffen. Diese in
Fig. 14
angegebenen Stücke bestehen aus einem mittlern Ring mit Vorsprüngen, von denen der
eine mit einer Druckschraube i versehen ist, wodurch das
Stück auf die Getriebespindel befestigt wird; während der andere ein in ein
Schwänzchen auslaufendes Stäbchen enthält, das man durch eine zweite Schraube k in zweckmäßiger Höhe erhält.
In Fig. 15
endlich sieht man die Spindel g mit den drei Getrieben
versehen, um welche die Vaucanson'schen Ketten laufen. Es ist bezüglich Fig. 11 noch
zu bemerken, daß die Platten l, l die Getriebe m umfassen, während die Getriebe f, f, sowie die in Fig. 13 und 14
abgebildeten Theile außerhalb angebracht sind, was eine Wiederholung der aus Fig. 11
ersichtlichen Anordnungen voraussetzt. Fig. 11 zeigt nur vier
Fäden, deren Anzahl aber leicht auf 40 gebracht werden kann.
Tafeln