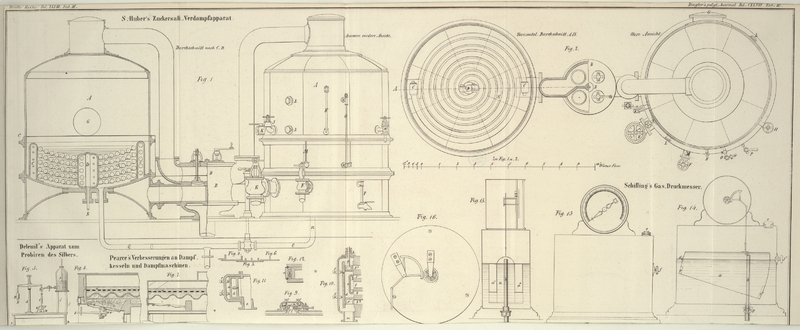| Titel: | Verbesserungen an Dampfkesseln und Dampfmaschinen, von John Ch. Pearce, Ingenieur der Bowling Eisenwerke bei Bradford. |
| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XXII., S. 100 |
| Download: | XML |
XXII.
Verbesserungen an Dampfkesseln und
Dampfmaschinen, von John Ch.
Pearce, Ingenieur der Bowling Eisenwerke bei Bradford.
Aus dem London Journal of arts, Juni 1857, S.
343.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Pearce's Verbesserungen an Dampfkesseln und
Dampfmaschinen.
Der erste Theil der Erfindung, welche am 22. Mai
1856 in England patentirt wurde, bezieht sich auf Verbesserungen in der
Construction der Dampfkessel, ihrer Oefen und Feuerzüge. Fig. 4 und 5 stellen Tförmige oder gerippte Eisenstücke dar, welche in Ringe
gebogen an die Kanten der benachbarten Platten genietet werden, um dem Feuerkasten
und den Feuercanälen etc. der Dampfkessel die nöthige Stärke zu geben. In einigen
Fällen ertheilt man der Construction eine größere Steifigkeit, indem man die Ränder
der gewöhnlichen Kesselplatten parallel mit den Nietlöchern, wie Fig. 6 zeigt, biegt. Diese
aufgebogenen Ränder der Platten und ebenso die Rippen, Fig. 4 und 5, sollten nie der
directen Einwirkung des Feuers ausgesetzt, sondern so angeordnet werden, daß sie mit
dem Wasser in Innern des Kessels in Berührung sind, wo sie sich zur Befestigung der
Stehbolzen und Strebestangen sehr gut eignen.
Um in einem gewöhnlichen cylindrischen Dampfkessel eine große Oberfläche des Rostes
und des obern Feuercanals, und zugleich einen hinreichenden Raum für Wasser und
Dampf zu erzielen, gibt man dem inneren Canal eine Dförmige Gestalt mit aufwärts gerichteter geraden Seite, und um seine
Zusammendrückung zu verhüten, wendet man die oben beschriebenen Methoden der
Verstärkung an, oder man macht die obere Seite des Feuercanals von einem Ende zum
andern wellenförmig.
Fig. 7 stellt
einen derartigen cylindrischen Kessel in Längendurchschnitte dar. Anstatt die oberen
Kanten der Seiten des Feuercanals der Wellenform des Dachs entsprechend
abzuschneiden, läßt man sie, wie die punktirte Linie a,
a
Fig. 7 zeigt,
gerade. Dieser Kessel ist in Ziegelgemäuer eingesetzt; Seiten- und
Bodencanäle für die durchstreichende Hitze haben die gewöhnliche Construction.
Die beschriebenen Methoden finden auch Anwendung auf eine neue
Dampfkessel-Construction, bei welcher der untere Theil des cylindrischen
Körpers weggelassen ist, und die untersten Ränder der Canalseiten mit den
correspondirenden Rändern der Platten, welche die Seiten des Kessels bilden,
vereinigt sind, wodurch ein breiter Canal mit parallelen geraden Seiten und offenem
Boden gebildet wird, der sich von einem Ende des Kessels bis zum andern
erstreckt.
Fig. 8 stellt
einen solchen Kessel in Längendurchschnitte dar. Der unter dem vorderen Ende
befindliche Ofen ist mit zwei Rosten, einem oberen und einem unteren versehen,
welche so angeordnet sind, daß das Brennmaterial von dem ersteren in theilweise
consumirten Zustande auf den zweiten abgesetzt wird. Diese Roste lassen sich
mittelst der Handhabe b und des Doppelhebels c in senkrechter Richtung auf- und niederbewegen,
wobei die Bewegung der aneinanderstoßenden Enden stets eine entgegengesetzte ist, so
daß beide Roste sowohl eine einzige geneigte Ebene als auch zwei verschieden
geneigte Ebenen bilden können. Diese Anordnung setzt den Heizer in den Stand, den
Luftzutritt zu reguliren, und erleichtert zugleich die Reinigung der
Feuerstelle.
Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf die Anordnung und Construction von
Schieberventilen für Dampfmaschinen und Locomotiven.
Zur Verminderung der Reibung und des Dampfverlustes bedient man sich einer losen
adjustirbaren Platte, welche mittelst Adjustirschrauben, die durch den Ventilkasten
gehen, mit der Rückseite
des Ventils in dichter Berührung erhalten wird. Das Ventil ist ein einfacher Rahmen
mit vollkommen paralleler vorderen und hinteren Fläche von gleicher Form und
Dimension.
Fig. 8 stellt
ein solches Ventil in Anwendung auf einen gewöhnlichen Dampfmaschinencylinder im
Längendurchschnitte dar. a ist die adjustirbare Platte,
welche an den Seiten lose in den Ventilkasten paßt, und an den Enden durch die
Hervorragungen b, b in ihrer Lage erhalten wird. c, c sind die mit Schließmuttern versehenen
Adjustirschrauben, welche durch den Ventilkasten treten und die Platte a mit dem Ventil d in
dichter Berührung erhalten. Der Dampf strömt durch eine Seitenröhre und den
mittleren Eingang f in das Innere des Ventils, wo er
seinen vollen Druck auf die Platte a ausübt, und
dieselbe gegen die Enden der Schrauben c, c preßt,
während das Ventil zwischen den parallelen Flächen der adjustirbaren Platte und der
Cylinderfläche frei gleiten kann. Die Bewegung des Ventils wird vermittelst der
durch die Stopfbüchse h gleitenden Stange g regulirt. Befindet sich nun das Ventil im halben Hub,
so sind die beiden Oeffnungen s, s' auf der Dampfseite
geschlossen. In dieser Stellung ist das Ventil hinsichtlich des in ihm
stattfindenden Dampfdruckes vollkommen balancirt; und um das Gleichgewicht an
sämmtlichen Stellen des Hubes zu sichern, sind in der adjustirbaren Platte die
compensirenden Vertiefungen n, n¹, n² angebracht. Beim Oeffnen der
Einströmungsöffnung, um Dampf in den Cylinder zu lassen, nimmt das Ventil die in
Fig. 9
dargestellte Lage an, wobei der über der Oeffnung s
befindliche Theil seiner Vorderseite dem Dampfdruck ausgesetzt ist; da jedoch stets
eine entsprechende Fläche der entgegengesetzten Seite des Ventils einem ähnlichen
Drucke innerhalb der Vertiefung n ausgesetzt ist, so
bleibt das Gleichgewicht des Ventils ungestört. Beim Schließen der Oeffnung, um den
Dampf vom Cylinder abzusperren, wird das Gleichgewicht des Dampfdrucks im Canal s und der entsprechenden Vertiefung n mittelst kleiner, durch die Vorderfläche des Ventils
gebohrter Oeffnungen x hergestellt, so daß der
Dampfdruck auf das Ventil sich stets vollkommen balancirt.
Die Figuren 10
und 11 sind
Längen- und Querdurchschnitte eines solchen Ventils in Anwendung auf eine
Maschine mit doppeltem Cylinder. a ist die adjustirbare
Platte; c, c sind die Adjustirschrauben; d ist der Schieber mit einer Platte v, um den Dampf beider Cylinder zu trennen; f der Hauptcanal; s,
s¹, die Eingänge des Hochdruckcylinders; s², s³ die Eingänge des
Niederdruckcylinders; e die Dampfröhre; m die Saugröhre. Aus Fig. 10 erhellt, daß die
aufwärts gehende Bewegung des Ventils dem Dampf gestattet, aus dem Niederdruckcylinder
durch den Canal s² in die Saugröhre m zu entweichen; gleichzeitig strömt Dampf aus dem
Hochdruckcylinder durch die Oeffnungen s, s³ in
das entgegengesetzte Ende des nämlichen Cylinders, und ebenso strömt frischer Dampf
durch den Eingang s¹ aus dem mittleren Canal f in das entgegengesetzte Ende des Hochdruckcylinders.
Auf ähnliche Weise bewirkt beim rückgängigen Hub des Ventils der Wechsel der
Ventilbewegung eine correspondirende Oeffnung der Canäle.
Der dritte Theil der Erfindung betrifft Verbesserungen in der Construction der metallenen Kolbenliederung. Rings um die innere Fläche
des Packungsringes ist eine Reihe von Vertiefungen angebracht, zur Aufnahme anderer
Ringe von großer Elasticität, die, als Federn wirkend, den äußeren Ring gegen die
Fläche des Dampfcylinders drücken. Fig. 12 ist ein
Querschnitt dieser Liederung. a ist die äußere Packung
oder der Reibungsring; b, b, b sind die inneren
elastischen Ringe. Der äußere Ring muß gleichmäßig dick seyn, genau den Durchmesser
des Cylinders haben und in geeigneter Richtung durchschnitten seyn, damit er sich
bei erfolgender Abnützung ausdehnen kann. Die Federringe müssen einen bedeutend
größeren Durchmesser, als der innere Durchmesser des Packungsringes haben, damit sie
den letztem mit Spannkraft gegen die Cylinderfläche drücken können. Bei der
Construction großer Kolben ist es hie und da vorzuziehen, den Federringen einen
schrägen Durchschnitt zu geben, um eine gleichmäßigere Elasticität zu erzielen. Beim
Zusammensetzen der Ringe ist es nothwendig, die Enden der Packung auseinander zu
biegen, um die Federn einsetzen zu können. Die Fugen sind in gleichen Abständen
anzuordnen, so daß jeder Ungleichmäßigkeit in der Elasticität des einen Ringes durch
die anderen entgegengewirkt werden kann, um die genaue Kreisform des äußeren Ringes
zu bewahren. Die beschriebene Packung wird auf die übliche Weise zwischen die
Flantschen des Kolbens genau eingepaßt. Um die Dampfentweichung durch die schräge
Fuge des Packungsringes zu verhindern, sind schmale Messingstreifen in geeignete
Vertiefungen genau eingepaßt, so daß sie die Fugen bedecken.
Tafeln