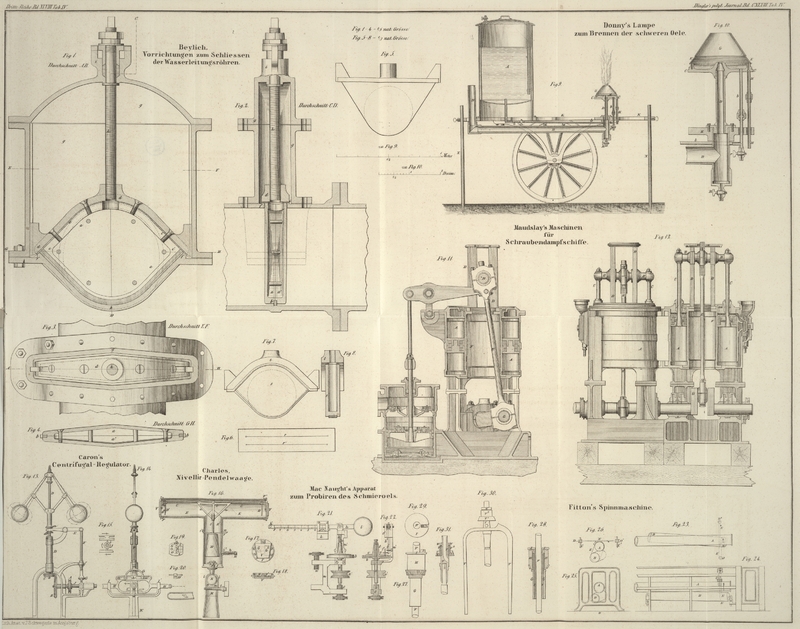| Titel: | Nivellir-Pendelwaage, von Hrn. Charles, Optiker zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 148, Jahrgang 1858, Nr. XLII., S. 186 |
| Download: | XML |
XLII.
Nivellir-Pendelwaage, von Hrn. Charles, Optiker zu
Paris.
Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1858, S.
43.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Charles' Nivellir-Pendelwaage.
Die bei Nivellements gewöhnlich in Anwendung kommenden Wasserwaagen sind mit mehreren
bedeutenden Uebelständen behaftet, denen man schon auf verschiedene Weise, jedoch ohne vollständigen
Erfolg, abzuhelfen bemüht war. Diese Uebelstände haben ihren Grund in den
Dimensionen des Apparates, welche einen leichten Transport nicht gestatten, in der
Zerbrechlichkeit desselben, in der Nothwendigkeit, die in die Flaschen zu füllende
Flüssigkeit mit sich zu führen, in der Schwierigkeit, sich des Instrumentes bei
windigem Wetter zu bedienen, indem dabei immer eine sehr merkbare Schwankung im
Niveau stattfindet, wodurch die Operationen unvollkommen ausfallen u.s.w.
Durch die von Hrn. Charles erfundene Pendelwaage werden
diese Mängel beseitigt. Fig. 16 stellt diesen
Apparat im Längendurchschnitte dar. Die Figuren 17, 18, 19 und 20 sind
Details desselben. Er besteht aus zwei unter einem rechten Winkel an einander
gelötheten Röhren E und E'.
In der horizontalen Röhre E ist an einer beweglichen
Achse c ein stählerner Waagbalken C befestigt und rechtwinkelig mit einer verticalen Stange o verbunden. Letztere trägt ein Gewicht B aus Blei oder einem sonstigen Metall. Dieses Gewicht
hat den Zweck, die Stange o in einer verticalen, mithin
den Waagbalken C in einer vollkommen genau horizontalen
Lage zu erhalten. An die Enden des Waagbalkens C sind
zwei Diopter D und D'
befestigt, wovon das letztere, welches in Fig. 19 und 20 besonders
abgebildet, auf und nieder beweglich ist. Diese Bewegung geschieht mit Hülfe einer
kleinen Schraube P. Die Diopter bieten einen conischen
Visirpunkt G und ein mit zwei metallenen Kreuzfäden
versehenes Fenster t dar; sie haben das Eigenthümliche,
daß der Visirpunkt dem Vereinigungspunkte der beiden Drähte i und i' entspricht, so daß, von welcher Seite
man auch das Instrument anlegen mag, der Punkt oder die Richtung des Korns sich
immer erkennen läßt.
Nachdem man eines der Diopter D an den stets horizontalen
Waagbalken befestigt hat, ist es wichtig bei dieser Lage das entgegengesetzte
Diopter D¹ so zu bewegen, daß man eine directe
Korrespondenz des Visirpunktes mit dem Kreuzungspunkt der gegenüberliegenden Fäden
erhält, und die Operation zu wiederholen, indem man durch den gegenüberliegenden
Theil visirt, um sich der vollkommenen Uebereinstimmung in beiden Lagen zu
vergewissern.
Der Cylinder E ist an seinen beiden Enden durch zwei
Deckel F und F¹
geschlossen, deren jeder, wie die Punktirung in Fig. 17 anzeigt, mit
Oeffnungen G und G²
versehen ist, welche dem Visirpunkt G¹ und den
Fenstern t der Diopter entsprechen. Zur Sicherung gegen
den Wind, welcher sonst in das Instrument dringen und die Diopter D und D¹ bewegen
könnte, dienen die Gläser V, Fig. 17, welche in
geeignete Rinnen eingeschoben und vermöge ihrer etwas conisch zulaufenden Form sowie
durch Federn z in ihrer Lage gehalten werden. Nach Zurückschiebung
der Federn z lassen sich diese Gläser leicht
herausnehmen. Eine bei r¹ befestigte Feder R drückt auf das Gewicht B
und hindert die Hin- und Herbewegung desselben, wenn das Instrument sich in
Ruhe befindet. Diese Feder läßt sich, wenn das Gewicht frei spielen soll, mittelst
einer Schraube in die Höhe heben.
Zum Behuf des Transportes von einer Station zur andern ist am Cylinder E ein Drücker H nebst Feder
h angebracht, dessen Stange durch eine Hülse s ins Innere des Cylinders sich erstreckt. Indem man
diese Stange einwärts schiebt, drückt ihr inneres Ende das Gewicht B gegen die Wand des Cylinders, während ein an der
Stange angebrachtes Häkchen sich in die Oeffnung r² der Hülse s legt und die Stange in
dieser Lage erhält. Der ganze Apparat ist um ein an dem oberen Ende des Stativs
befindliches Kugelscharnier K beweglich, dessen in
einige Theile gespaltene Hülse l, l vermittelst der
Schraube L mehr oder weniger dicht an die Kugel gedrückt
werden kann.
Es wurde oben erwähnt, daß jedes der beiden Diopter seine Visiröffnung und sein
Fadenkreuz enthält, so daß zwei Sehfelder, eines zur Rechten und eines zur Linken,
vorhanden sind. Um einen Uebelstand zu beseitigen, der eintreten könnte, daß man
nämlich durch die eine Oeffnung, anstatt nach dem correspondirenden Fadenkreuz, nach
der in diagonaler Richtung gegenüberliegenden Oeffnung visire, bringt der Erfinder
längs dem Waagbalken eine leichte Metallschiene oder mindestens einen einfachen
Papierstreifen an, welcher den Cylinder E in zwei Theile
scheidet, deren jeder somit seine Visiröffnung und sein Fadenkreuz enthält.
Tafeln