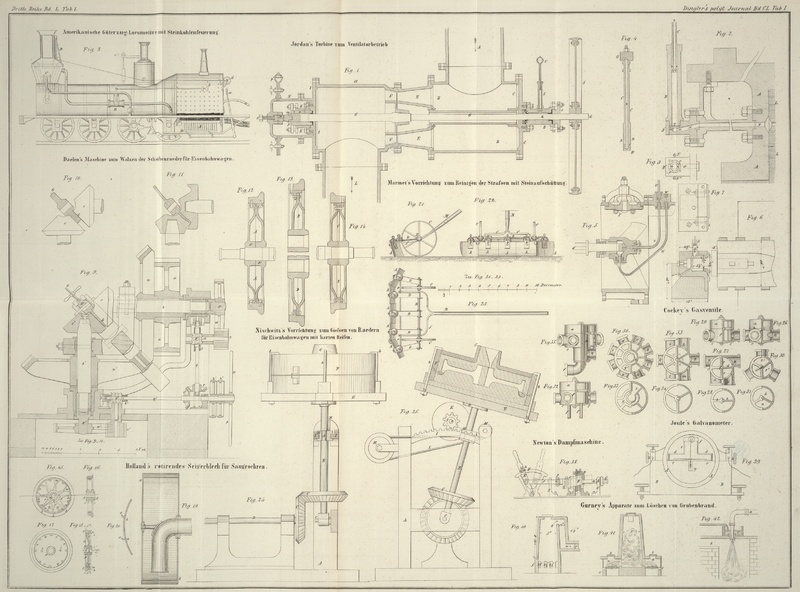| Titel: | Jordan's Turbine, nach Henschel-Jonval, horizontale Aufstellung und mit sogenannter Schmierpresse versehen; von Professor Dr. Rühlmann. |
| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. III., S. 4 |
| Download: | XML |
III.
Jordan's Turbine, nach
Henschel-Jonval, horizontale Aufstellung und mit sogenannter
Schmierpresse versehen; von Professor Dr. Rühlmann.
Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,
1858 S. 159.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Jordan's Turbine.
Bei einer vom königlichen Finanz-Ministerium angeordneten Wanderung durch
diejenigen Districte des hannoverschen Oberharzes, welche von besonderer Wichtigkeit
für die Bergmaschinenmechanik sind, wurde ich auf dem Puddel- und Hammerwerke
Mandelholz nicht wenig durch eine Henschel-Jonval-Turbine überrascht, welche man zum Betriebe
eines Schiele'schen Flügelgebläses mit entschiedenem
Erfolge anwandte. Der Constructeur dieser Turbine ist der Maschinenmeister Jordan, am Bauhofe zu Clausthal (Sohn des Bergraths Jordan, den Berg- und Maschinen-Ingenieuren hinlänglich
durch die höchst gelungenen Wassersäulenmaschinen etc. bekannt), der auch bereits
für industrielle Zwecke Henschel-Jonval-Turbinen zur größten Zufriedenheit der
Fabrik- und Werkbesitzer lieferte.
Für den Umfang des Königreichs Hannover ist diese Turbine
die erste mit horizontaler Aufstellung, d.h. von der
Anordnung, daß die Betriebswelle (Wasserradwelle) horizontal liegt, eine Methode,
die in vielen Fällen außerordentliche Vorzüge hat, z.B. bequemer Zugang zu den
Zapfen, Ersparung von Kegelrädern zur Umsetzung der Bewegung etc., und gewiß noch
mehrfache Nachahmung finden wird.Vorher war mir diese Turbinengattung nur in Zeichnungen der Redtenbacher'schen Maschinenbau-Schule
vorgekommen.
Da Hr. Jordan selbst ausführlichere Mittheilungen über
seine Turbine in der Zeitschrift des Architekten- und
Ingenieur-Vereins für das Königreich Hannover zu machen gedenkt, worauf ich
Fachmänner im Voraus aufmerksam machen möchte, so beschränke ich mich hier nur auf
allgemeine Angaben, so wie speciell auf das höchst beachtenswerthe Verfahren zum
Oelen der betreffenden Lagerstellen der Betriebswelle.
Hierzu zeigt Fig.
1 eine Abbildung (1/12 wahrer Größe) der Jordan'schen Turbine, und zwar im Aufrisse und
Horizontal-Durchschnitte. Das Aufschlagwasser (5 3/4 Kubikfuß per Secunde bei 22 1/4 Fuß Gefälle) wird durch das Rohr
A zugeführt, gelangt in den horizontalen Kasten B, mit Deckel C und
Stopfbüchse D versehen, in den Leitcurven-Apparat
E und aus diesem in das Rad F, welches mit seiner Nabe auf der Betriebswelle G festgekeilt ist, deren Umdrehzahl per Minute
500 beträgt. Das aus dem Rade F abströmende Wasser wird
zuerst von dem Cylinder H aufgenommen, wieder mit Deckel
J und Stopfbüchse K
versehen, und fließt endlich durch das Verticalrohr L
ab.
Die äußerst sorgfältige Anordnung des Endzapfens m der
Betriebswelle G, dessen Aufnahme im verschlossenen
Oelgefäße N, mit Oelbehälter P etc., erhellt, so weit hier erforderlich, hinlänglich aus der Zeichnung,
und werde deßhalb nur bemerkt, daß die Drückungen p und
r der Stopfbüchsen K und
D aus Rothguß angefertigt und betreffende
Lederstulpe der Dichtungen in der Zeichnung ganz schwarz angegeben sind, so wie auch
der ganze Hals D nebst der Schmierpresse S aus Rothguß besteht. Endlich werde noch erwähnt, daß
der in der Welle G eingesetzte Spurzapfen m
(wahrscheinlich) aus
Gußstahl, das durch eine Schraube s stellbare Lager n (die Pfanne) jedoch ebenfalls aus Rothguß hergestellt
ist.
Die Schmierpresse S ist genau dieselbe, wie solche
besonders vom Hrn. Bergrath Jordan bei dessen
Wassersäulenmaschinen und überhaupt überall da mit großem Nutzen in Anwendung
gebracht wurden, wo große Drücke auf gewöhnliche Weise eingeführtes Oel fast sofort
wieder heraustreiben.
Fig. 2 stellt
die bei der Lautenthaler Wassersäulenmaschine an der Stopfbüchse A der Treibkolbenstange angebrachte Schmierpresse im
Vertical-Durchschnitte dar, wobei B ein
Pumpenstiefel, in welchem sich der Röhrenkolben C
bewegen kann, der in Fig. 4 besonders gezeichnet ist. Am unteren Theile ist dieser Kolben mit
einer Liederung D versehen, so wie in der Erweiterung,
unterhalb bei E ein (Fig. 4) schwarz
gezeichnetes Lederscheibchen sichtbar ist, was ein Ventil bildet und für gewöhnlich
auf zwei Stiftchen ruht, die in den Zeichnungen hinlänglich zu erkennen sind. Beim
Niederdrücken des Kolbens C legt sich das gedachte
Scheibchen vor die untere Oeffnung der Höhlung Z des
Kolbens und verhindert damit das Zurücktreten des Oeles, was vorher durch die
Höhlung Z und weiter in dem Canale x der Stopfbüchsenliederung L zugeführt wurde. Der erforderlich niederwärts gerichtete Druck des
Kolbens C wird durch Gewichte erzeugt, welche an Stangen
F, F¹, Fig. 3 (Grundrißfigur von
B¹, Fig. 2), aufgehangen sind,
die wieder zu dem Stege G, Fig. 4, gehören, der oben
auf dem Kolben C befestigt ist. Damit beim Einführen
frischen Oeles und beziehungsweise In-die-Höheziehen des Kolbens C (wobei das Kolbenventil die Lage annimmt, welche in
den Figuren gezeichnet ist, d.h. auf den beiden Stiftchen ruht) das bereits im
Canale x, y befindliche Oel nicht vom Drucke in der
Stopfbüchse in den Cylinder B getrieben werden kann, ist
im Gehäuse B¹ ein zweites Lederscheibchen m, n als Ventil angebracht, was sich gegen die untere
Fläche q von B legt, wenn
das Oel in der Richtung von y nach x laufen will oder zurückgedrückt wird, dagegen auf vier
Züngelchen (Segmenten) r, r ruht und damit die nach x führende Oeffnung nur theilweise verschließt, wenn
durch Niederdrücken des Kolbens C frisches Oel von q nach x, y getrieben werden
soll. Bei der Mandelholzer Turbine reicht übrigens das eigene Gewicht des Oelgefäßes
U hin, das Oel unter dem erforderlichen Druck nach
den Reibungsstellen Q des Halslagers D zu treiben.
Vergleichsweise wurde Fig. 5 die Oelzuführung bei einer Turbine mit horizontaler Betriebswelle
G aufgenommen, welche von Redtenbacher construirt seyn soll, und wobei die Absicht unverkennbar ist,
durch eine der Röhrchen V mittelst einer Pumpe Oel nach
den Zapfen zu treiben, welches gleichzeitig, bei richtiger Communication, im zweiten Röhrchen W emporsteigen und dadurch die Wirksamkeit der Anordnung
zu erkennen geben würde. Außerdem dürfte noch auf das gehörig angebrachte Mannloch
P aufmerksam zu machen seyn, wodurch der Zugang zum
Turbinenzapfen sehr erleichtert wird.
Endlich zeigt Fig.
6 noch eine bewährte Construction für den unteren stets im Wasser
laufenden Zapfen einer Archimedes-Wasserschraube (Tonnenmühle), wobei S die betreffende Schmierpresse andeuten soll.
Tafeln