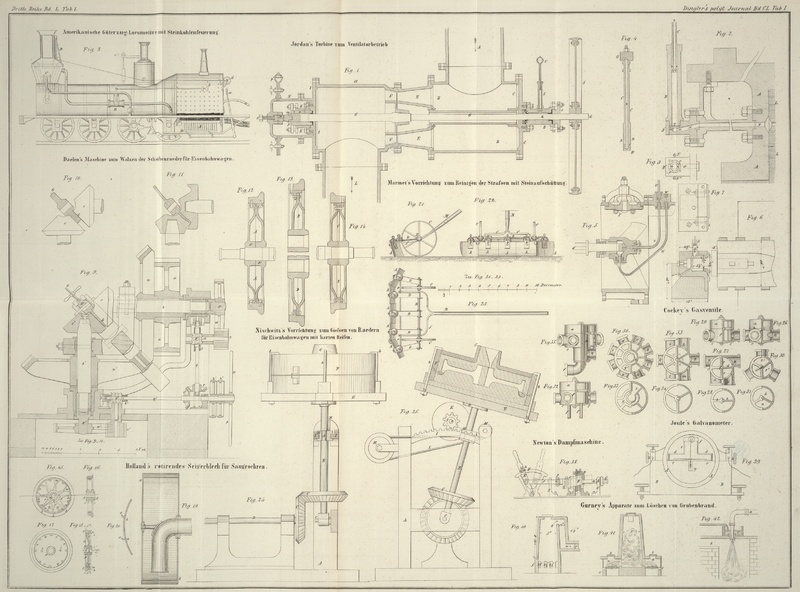| Titel: | Ch. Cockey's Ventile für Gasanstalten. |
| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. IX., S. 18 |
| Download: | XML |
IX.
Ch. Cockey's Ventile für
Gasanstalten.
Aus dem London Journal of arts, Juli 1858, S.
18.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Cockey's Ventile für Gasanstalten.
Vorliegende Erfindung (patentirt in England am 19
October 1857) bezieht sich auf eine eigenthümliche Construction und
Anordnung des Gasventils, um das Gas auf eine einfache und leichte Weise in
verschiedene bei seiner Fabrication in Anwendung kommende Behälter leiten und seine
Stromrichtung überhaupt ändern zu können.
Fig. 26
stellt das Ventil in einer Form, wobei es den Zweck der gewöhnlichen Dreiweghähne
versieht, im theilweisen Aufriß und im Durchschnitte dar. Fig. 27 ist ein
theilweiser Horizontaldurchschnitt des unteren Theils, Fig. 28 ein
Horizontaldurchschnitt des oberen Theils desselben, und zwar von Unten betrachtet.
Das obere Ventil besteht aus einer cylindrischen Büchse, welche durch eine centrale
Scheidewand b in zwei gleich große Zellen oder Kammern
getheilt ist. Die untere Fläche dieser Büchse und die obere Fläche der unteren
Büchse c sind auf einander abgeschliffen, so daß sie mit
einander in Berührung gebracht, eine gasdichte Verbindung bilden. Die untere Büchse
c ist durch die radialen Scheidewände d, d und e, e in vier
Kammern getheilt. Jede dieser Kammern ist mit einer Aus- und
Einströmungsröhre verbunden. Die Büchse a läßt sich um
die centrale Spindel f drehen, welche in der unteren
Büchse c befestigt ist. g
ist das Einströmungsrohr, k das Ausströmungsrohr.
Wenn die Scheidewand b der Büchse a mit der Scheidewand d, d der unteren Büchse
coincidirt, so geht der Gasstrom direct durch den Nebenweg nach dem Ausströmungsrohr
k. Sollte es erforderlich seyn, den Strom durch die
Röhre h nach einer Stations-Gasuhr oder einem
andern Apparat abzulenken, so braucht man nur der Büchse a eine Viertelsdrehung zu geben, bis nämlich ihre Scheidewand b mit der Scheidewand e, e
der unteren Büchse coincidirt, worauf der Strom augenblicklich durch die Röhre i nach dem Ausströmungsrohr k geleitet wird. Die Drehung der oberen Büchse a kann etwa mittelst eines Schlüssels bewerkstelligt werden. An jedem
Ventil ist ein Zeiger angebracht, welcher angibt in welcher Richtung die obere
Büchse gedreht werden muß.
Die Figuren
29, 30
und 31
stellen eine für zwei Gasbehälter dienliche Modification des beschriebenen Ventils
dar. Die Büchse a ist in zwei Kammern getheilt, wovon die
eine doppelt so groß ist, als die andere. Die Büchse c
ist in drei Zellen oder Kammern c*, d* und e* von gleichem Rauminhalt getheilt, von denen jede ihre
correspondirende Ein- oder Ausströmungsöffnung hat. Je zwei dieser Kammern
können durch die geräumigere Kammer der Büchse a mit
einander verbunden werden, während die dritte mit der kleineren Kammer in
Communication bleibt. Das Gas tritt aus dem Gasbehälter bei e* ein. Wenn nun die Kammern c* und d* dadurch mit einander in Verbindung gesetzt sind, daß
man die größere Kammer der oberen Büchse a über
dieselben gebracht hat, so strömt das Gas aus c* nach
dem Ausgang d*, während die Kammer e* durch die kleine Zelle der oberen Büchse geschlossen
ist; und wenn die größere Kammer der oberen Büchse so gedreht wird, daß sie die
Kammern c* und d* verbindet,
so wird dadurch der Eingang c* abgesperrt, und das Gas
strömt nun aus dem zweiten Gasbehälter durch die Kammern e* und d*. Bringt man die größere Kammer der
oberen Büchse über die beiden Kammern c* und e*, so treten dadurch die beiden Gasbehälter nur unter
sich in Communication, und beide sind alsdann von dem Ausgang d* abgesperrt. Dreht man aber die Büchse a in
eine solche Lage, daß ihre innere Scheidewand nicht mit einer der inneren
Scheidewände der unteren Büchse c coincidirt, so
befinden sich beide Gasbehälter gleichzeitig mit dem Ausgang d* in Communication.
Die Figuren
32, 33
und 34
stellen eine für zwei Reinigungsapparate dienliche Modification eines Ventils dar,
mit dessen Hülfe man die Strömung jedes Reinigers nach den Ausgängen zu wechseln im
Stande ist; dieses Ventil erfüllt den nämlichen Zweck, wozu sonst vier Ventile
nöthig sind. h, i und l, m
sind die nach und von den beiden Reinigungsapparaten führenden Röhren; g und k sind die Ein-
und Ausgänge des Ventils. Jede Zelle oder Kammer der oberen Büchse a ist weit genug, um irgend zwei Zellen oder Kammern der
unteren Büchse c zu bedecken oder mit einander zu
verbinden. Auf diese Weise geht, indem man eine Kammer der oberen Büchse über die
Kammern bringt, welche von den Röhren g, h der unteren
Büchse führen, der Gasstrom von dem Eingang g nach der
Kammer h und von da in den Reiniger, von wo er durch die
Kammer i nach dem Ausgang k
zurückkehrt, während die beiden Kammern l, m, welche
nach dem zweiten Reiniger führen, abgesperrt sind. Dreht man die obere Büchse so,
daß eine Kammer über die Röhren g und m gelangt, so kommt der mit den Röhren l und m in Verbindung
stehende Reiniger in Thätigkeit, während der erste Reiniger abgesperrt ist. f, f sind Abzugsröhren für den in den Kammern der
unteren Büchse c sich sammelnden Theer und andere
Ablagerungen.
Die Figuren
35, 36
und 37
stellen eine für vier Reinigungsapparate dienliche Modification dar, bei welcher das
eine Ventil den Gasstrom durch drei Reiniger leitet, während stets ein in Rotation
befindlicher Reiniger abgesperrt ist. Dieses Ventil wird in der Mitte der vier
Reiniger angeordnet. Das Gas tritt bei der Einströmungsröhre ein, steigt in die
obere Büchse a, wo es durch eine Kammer nach dem ersten
in Thätigkeit befindlichen Reiniger gelangt, dessen Eingang mit der Röhre b und dessen Ausgang mit der Röhre c verbunden ist. Hierauf gelangt das Gas in den zweiten
Reiniger, dessen Eingang mit d und dessen Ausgang mit
e in Verbindung steht; sodann nach dem dritten
Reiniger, dessen Eingang mit f und dessen Ausgang mit
g verbunden ist; von da strömt das Gas durch den
Canal g* der oberen Büchse a
nach dem Ausgang r und nach der Ausströmungsröhre k. Wenn der obere Cylinder auf die beschriebene Weise
angeordnet ist, so sind die Kammern h und i und der damit verbundene vierte Reinigungsapparat
abgesperrt. Dreht man die obere Büchse so, daß die Kammer b über die Kammer d gelangt, so kommt der mit
den Röhren d und e
verbundene Reiniger zuerst in Thätigkeit und der mit b
und c verbundene wird abgesperrt.
Tafeln