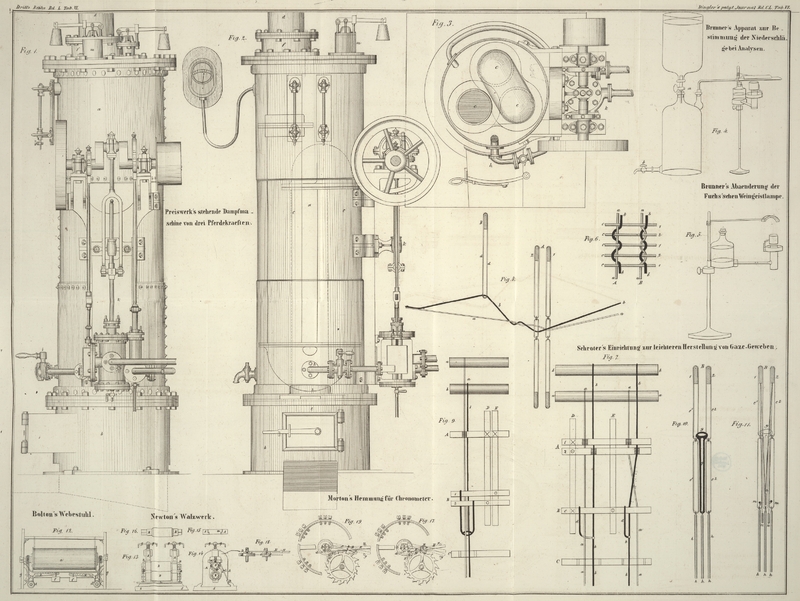| Titel: | Verbesserungen an den Hemmungen der Chronometer, von G. Morton zu Keighley in Yorkshire. |
| Fundstelle: | Band 150, Jahrgang 1858, Nr. LXXXVII., S. 339 |
| Download: | XML |
LXXXVII.
Verbesserungen an den Hemmungen der Chronometer,
von G. Morton zu
Keighley in Yorkshire.
Aus dem London Journal of arts, August 1858, S.
84.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Morton's Verbesserungen an die Hemmungen der
Chronometer.
Fig. 17
stellt die verbesserte Hemmung (patentirt in England am 17. October 1856) im Grundrisse, Fig. 18 einzelne Theile
derselben in der Seitenansicht dar. A ist das
Hemmungsrad; B der hohle Halbcylinder, gegen dessen
Paletten die Zähne des Hemmungsrades abwechselnd sich lehnen; C die Unruhspindel mit einem Cylinder D,
welcher einen Rubinzahn a enthält, der dem Halbcylinder
B seine oscillirende Bewegung ertheilt. Die Spindel
b des Halbcylinders B
enthält einen Hebel E, mit dessen Hülfe die Bewegung von
dem Zahn a auf den Cylinder B übertragen wird. Die Bewegung des Hebels E
und des Halbcylinders B hat Aehnlichkeit mit der
gewöhnlichen Hebelhemmung, jedoch mit dem Unterschied, daß von dem Hemmungsrade A aus kein Impuls durch Vermittelung des Hebels E gegeben wird. Zwei gehärtete Stahlstifte c, c ragen von der Seite des Hebels E hervor. Zwischen diese Stifte tritt der Zahn a, wenn er sich an der dem Cylinder B nächstliegenden Seite herumbewegt, und während dieser
Bewegung bringt er den Hebel aus der ausgezogenen in die punktirte Lage, und die
Rubinpalette e läßt das Hemmungsrad A um einen Zahn weiter rücken. d ist die Palette welche den Impuls von dem Hemmungsrad empfängt. Diese
Palette ist ein an dem größeren Cylinder der Unruhspindel befestigter Rubin. An den
Contactstellen von B sind gleichfalls Rubine befestigt,
nämlich bei e an der äußeren Seite, gegen die sich der
Zahn 1 des Hemmungsrades lehnt, und an der inneren Seite bei f, wo der Zahn aufgehalten wird, wenn er von e
fällt.
Das Spiel der Vorrichtung ist nun folgendes. Angenommen die Unruhe bewege sich von
der linken zur rechten Seite, so tritt der Zahn a bei
seiner Bewegung zwischen die Stifte c, c, und führt nun
den Hebel E in die durch Punktirung angedeutete Lage.
Während dieser Bewegung treten die Stifte c, c in die
Höhlung des Cylinders D, worin sich der Zahn befindet.
Wenn sich der Hebel der punktirten Mittellage nähert, so ist der Zahn 1 von dem
Rubinstift e ausgelöst. Sobald dieser Vorgang
stattfindet, gelangt die Palette d in die punktirte Lage
d¹ und der Zahn 1 wird unmittelbar darauf
von dem Rubin e frei; der Zahn 2 aber fällt auf die
Treibpalette d¹ in die Lage d¹, indem er sich gegen diese Palette lehnt, bis
der Zahn 1 durch den Rubin f an der inneren Seite des
Cylinders B aufgehalten wird, worauf das Hemmungsrad A in der punktirten Lage bleibt. Somit empfängt die
Palette d den Impuls des Zahns 2 bis er in die punktirte
Lage 2ª gelangt. Während der Zahn 1 auf dem Rubin f ruht, führt die Unruhe den Hebel E in die
punktirte Lage und vollendet ihre Schwingung von links nach rechts; dann kehrt sie
durch die Kraft der Spiralfeder zurück und bringt den Hebel in seine Mittellage
zurück, indem der Zahn a wieder zwischen die Stifte c, c tritt. Die letzteren stoßen gegen die Peripherie
des kleineren Cylinders D, wenn ein Stoß oder eine
Gegenbewegung stattfinden soll, um den Hebel in stabiler Lage zu erhalten, wenn der
Zahn a die Stifte verläßt. Nähert sich der Hebel E seiner mittleren Lage, so wird der Zahn 1ª von
dem Rubin f frei, worauf der folgende Zahn auf den Rubin
e fällt, wobei er dem Echappement nur eine sehr
kurze Bewegung gestattet, und die Unruhe macht ihre Schwingung, indem sie die
Palette d mit sich nimmt. Aber bei dieser Bewegung von
der Rechten zur Linken verläßt diese Palette den Zahn des Hemmungsrades, welches
sich in diesem Momente in der ausgezogenen Lage befindet. Der Zahn des Hemmungsrades
bleibt auf dem Rubin e bis zur rückgängigen Bewegung der
Unruhe, worauf die Palette d in der nämlichen Richtung
einen neuen Impuls empfängt. Es erhellt hieraus, daß die Unruhe nur während ihrer
Bewegung nach der einen Richtung den Impuls empfängt, und daß dieser Impuls während
einer langen Bewegung ungefähr gleich dem Abstande eines Zahns des Hemmungsrades von
einem andern mitgetheilt wird, wogegen die Bewegung des Hemmungsrades während der
rückgängigen Schwingung der Unruhe sehr kurz ist, und der Unruhe keinen Impuls
ertheilt. Durch dieses Mittel wird das Spiel sehr regelmäßig, während das
Echappement abgesonderter und freier schwingen kann als andere Hemmungen. g, g sind Stifte, welche die Bewegung des Hebels E einschränken. Da die Rubine e und f mit der Spindel b concentrische Kreisbogen sind, so hält die oscillirende Bewegung des
Cylinders nur den Zahn des Hemmungsrades zurück, und theilt der Unruhe keine
Bewegung mit; die Rubine wälzen sich nur, während der Cylinder in Bewegung ist, auf
diesem Zahn ab. Sobald der letztere von dem Rubin f frei
ist, fällt er aus der punktirten in die ausgezogene Lage und macht den kurzen Fall
auf den Rubin e, welcher inzwischen angekommen ist, um
ihn plötzlich anzuhalten. Der Rubin f schiebt sich in
dem nämlichen Augenblick dazwischen, wo der Rubin e von dem Zahn
weggezogen wird, um den längeren Fall zu thun, während dessen er der Unruhspindel
den Impuls ertheilt.
Fig. 19
stellt eine Modification der beschriebenen Hemmung im Grundrisse dar. A ist das Hemmungsrad; B,
der Palettehälter. Die Rubinpaletten e und f sind cylindrische, mit der Spindel b concentrische Stücke, und umfassen zwei Zähne. Der
lange und der kürzere Fall wird eben so, wie oben regulirt. Im vorliegenden
Beispiele ist a ein Rubinstift, anstatt des oben
beschriebenen Zahns, welcher auf den Hebel wirkt, indem er sich in die Gabel c, c legt, und deren Bewegungen genau, wie oben
beschrieben wurde, controlirt. Die Rubinpalette d
empfängt ihren Impuls in der Lage d¹ und während
des Falles des Zahns 2 in die punktirte Lage 2ª. Der den Rubin e verlassende Zahn 1 fällt nicht direct auf den Rubin
f, weil sich zwischen e
und f ein Zahn befindet.
Tafeln