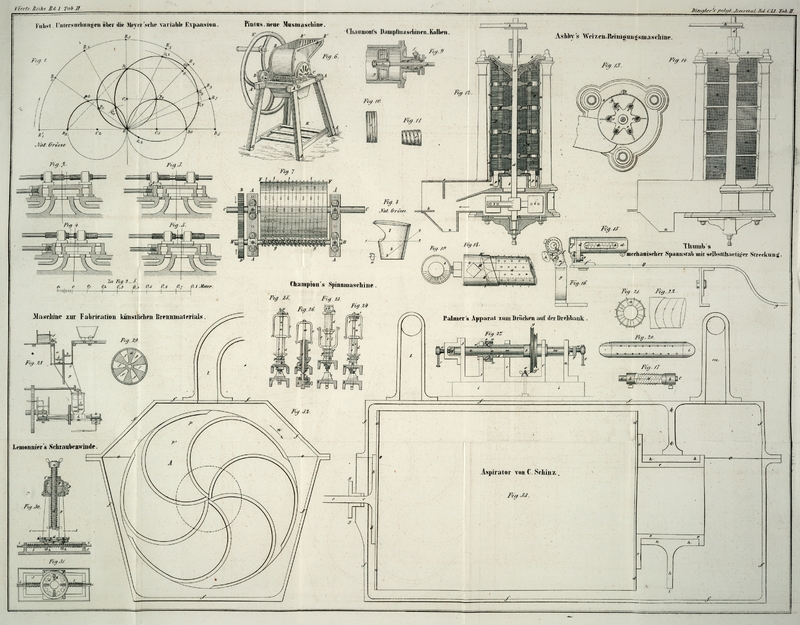| Titel: | Verbesserungen an den Schraubenwinden, von Hrn. Lemonnier. |
| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXII., S. 95 |
| Download: | XML |
XXII.
Verbesserungen an den Schraubenwinden, von Hrn.
Lemonnier.
Aus
Armengaud'sGénie
industriel, Octbr. 1858, S. 203.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Lemonnier's Verbesserungen an den Schraubenwinden.
Die jetzigen Wagenwinden gestatten wegen ihrer Einrichtung nur eine sehr beschränkte
Benutzung. Der Erfinder war bemüht, diese durch die hier zu beschreibenden
Abänderungen und Verbesserungen (patentirt in Frankreich am 20. März 1858) auszudehnen; sie bestehen:
1) in einer neuen Bewegungsart der Schraubenspindel, nämlich mittelst eines
Schraubenrades und einer Schraube ohne Ende, an deren Welle man eine oder zwei
Kurbeln anbringt;
2) in der Methode, nach Belieben die eigentliche Winde von ihrem Sockel abnehmen zu
können, um sie entweder als gewöhnliche, leicht transportirbare Wagenwinde zu
benutzen, oder, auf den Sockel gestellt, als Winde mit zwei Bewegungen zu anderen
Zwecken zu verwenden;
3) in der Beweglichkeit der Winde auf dem Sockel, in gerader Richtung nach Links und
nach Rechts, wobei sie unter verschiedenen Winkeln gestellt werden kann.
Fig. 30 ist
ein senkrechter Durchschnitt durch die Winde und deren Sockel.
Fig. 31 ist
ein horizontaler Durchschnitt in der Höhe der Linie 1–2.
Die eigentliche Winde besteht immer aus einer Schraubenspindel mit flachen Gängen A, welche am obern Ende mit der gewöhnlichen Gabel a versehen ist. Diese Spindel bewegt sich auf-
und abwärts, dreht sich aber nicht, da sie unten durch eine Scheibe e zurückgehalten wird, die mittelst vier Ausschnitten
zwischen den vier Ständern F biegt.
Dagegen dreht sich die Mutterschraube B, ohne ihre
Stellung zu verlassen, indem sie oben durch den Hals C
in derselben festgehalten wird.
Diese Mutterschraube ist mit einem Rad mit vertiefter schraubenförmiger Verzahnung
b versehen, in welches eine Schraube ohne Ende D eingreift.
Letztere liegt in zwei Zapfenlagern c, welche an dem
Halse C angebracht sind; ihre Zapfenenden haben
quadratische Angriffe, an welche Kurbeln gesteckt werden.
Die Mutterschraube ruht und dreht sich frei auf einem eisernen Ring E, welcher aus vier senkrechten Säulen F ruht, deren untere Enden durch die Schrauben g mit einer Scheibe G
verbunden sind.
So eingerichtet, ist die Wagenwinde vollständig und kann als solche überall
angewendet werden; man braucht nur mittelst einer oder beider Kurbeln die Schraube
D zu drehen, wodurch die Schraubenmutter B mittelst des Rades b
ebenfalls gedreht wird; die Schraubenspindel A geht dann
auf- oder abwärts, je nachdem man die Kurbel rechts oder links dreht.
Um die Wagenwinde zu vervollständigen, d.h. um eine Bauwinde daraus zu machen, setzt
man sie auf den Wagen H, an welchen zwei mit
Muttergewinden versehene Ohren h gegossen sind. Durch
diese Mutterschrauben geht eine Spindel I, die im Innern
des gußeisernen Sockels J angebracht ist.
Die Schraube I ist an den Enden mit zwei quadratischen
Zapfen i versehen, auf welche man Kurbeln stecken und
durch deren Drehung den Wagen nach rechts und links verschieben kann, und zwar bis zu dem einen oder dem
anderen Ende des Sockels. Diese Anordnung des Sockels bietet nichts eigenthümliches
dar, wohl aber diejenige des Wagens, welche den Vortheil gewährt, daß man die Winde
unter verschiedenen Winkeln auf den Sockel stellen kann. Hierzu braucht man nur die
Winde zu heben und sie so zu drehen, daß die vier Schrauben g in vier von den zwölf entsprechenden Löchern k treten können, mit denen die kreisrunde Platte H, welche den Wagen bildet, versehen ist.
Diese Platte ist überdieß mit vier kleinen Erhöhungen h'
versehen, die ihr als Führer auf dem Sockel dienen, und mit einem kreisrunden Rande
k', in dessen Inneres die Scheibe tritt, welche
einen Theil der Wagenwinde bildet. Dieser Rand genügt, um die Winde auf dem Wagen zu
erhalten und macht jede andere Befestigungsweise unnütz. Diese sehr einfache
Anordnung gestattet die Last zu theilen, wenn der Apparat transportirt werden soll,
wo dann ein Mann die Winde und ein anderer den Wagen trägt.
Letztere Bedingung ist zur leichtern Benutzung des Apparates sehr wichtig, besonders
beim Eisenbahnwesen, wo er einerseits als gewöhnliche Wagenwinde und andererseits
als vollständige Bauwinde dienen kann.
Tafeln