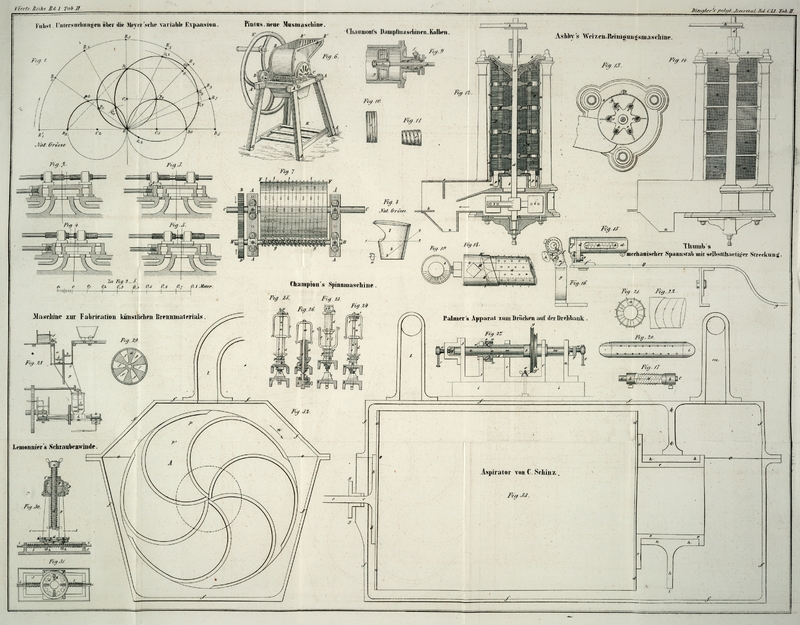| Titel: | Victor Thumb's und Comp., Mechaniker in Bludenz (Vorarlberg), mechanischer Spannstab mit selbstthätiger Streckung; beschrieben von Fr. Kohl. |
| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXIV., S. 100 |
| Download: | XML |
XXIV.
Victor Thumb's und Comp.,
Mechaniker in Bludenz (Vorarlberg), mechanischer Spannstab mit selbstthätiger Streckung;
beschrieben von Fr.
Kohl.
Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,
1858 S. 265.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Thumb's mechanischer Spannstab mit selbstthätiger
Streckung.
Die Hauptoperationen am Kraftstuhle sind in mannichfacher Weise erzielt und
selbstthätige Mechanismen auch zum Breithalten der Waare anwendbar gemacht worden.
Von den verschiedenen mechanischen Spannstäben welche in Gebrauch gekommen sind,
scheint der Rädchen- und der Walzentempel den praktischen Anforderungen am
besten zu entsprechen, der letztere aber, weil er an den neueren Stühlen weit
häufiger vorkommt, dem allerdings auch nicht selten benutzten Rädchentempel noch
vorgezogen zu werden.
Der Rädchentempel besteht aus kleinen, am äußeren Umfange mit scharfen Zähnen oder
Spitzen versehenen Scheiben. An beiden Seiten der Waare horizontalliegend
angebracht, sind die Sahlleisten über ein Bogenstück dieser Zahn- oder
Spitzenscheibchen gelegt und es wird die neuentstandene Sahlleiste in Folge der
Zeugfortrückung auch fortgehend von den Zähnen der dadurch umgedrehten Scheiben erfaßt und somit eine
Ausstreckung des Gewebes und dessen gewünschte Breithaltung bewirkt.
Bei dem Walzentempel treten an die Stelle der Zahnrädchen raspelartig gerauhte oder
ebenfalls mit Spitzen versehene, oder mit durchlöchertem oder erhaben gepreßtem
Bleche oder auch mit Kautschuk überzogene Walzen, welche jedoch auch die Enden einer
schmiedeisernen Welle bilden oder auf jeder Seite auch paarweise angewendet werden
können. In der Breite von mehreren Zollen von jeder Sahlleiste aus läuft die Waare
über die sie in gleicher Breite erhaltenden Walzen und wird häufig durch die Ränder
einer rinnenförmigen Ueberdachung oder eines die untere Walzenfläche umgebenden
Troges straffer auf die Walzen angedrückt.
Nach dieser kurzen Andeutung über die Beschaffenheit des Rädchen- und des
Walzentempels ist deren Unterschieb leicht darin zu erkennen, daß bei dem ersteren
die Sahlleiste immer nur durch einzelne Zähne ergriffen und von einer geringen
Anzahl derselben festgehalten, die Waare dabei aber, weil die sie ergriffenen Zähne
in horizontaler Ebene nach Auswärts laufen, fortgehend ausgezogen wird; bei den
Walzentempeln dagegen wird die Breithaltung der Waare durch eine größere Oberfläche
oder Zahl von Zähnen bewirkt, welche jedoch, da sie immer in verticaler Ebene
umlaufen, durch diese Bewegung das Gewebe nicht weiter spannen oder strecken,
sondern es nur auf der ihm durch anfängliche oder zeitweise wiederholte Streckung
gegebenen Breite erhalten können.
Aus der verglichenen Wirkung dieser beiden Spannstäbe läßt sich schon folgern, daß
der Rädchentempel die Sahlleisten allerdings stärker angreifen muß – ein
Grund, weßhalb man auch öfter den Walzentempel vorzieht. Dieser Vorzug würde sich
jedoch noch erhöhen, wenn dem Walzentempel ebenfalls die Eigenschaft einer
gleichmäßig fortgehenden Streckung der Zeugbreite nachgegeben würde, wie solche der
Rädchentempel besitzt.
Diese Aufgabe löst nun die Thumb'sche Construction.
Fig. 15 zeigt
die linker Hand anzubringende Hälfte eines vollständigen Walzentempels im
Grundrisse.
Fig. 16 die
Seitenansicht desselben Theiles von der inneren Seite gesehen. Die Spitzenwalze oder
Spannrolle a wird durch eine bereits oben erwähnte und
mit Spalt versehene messingene Rinne d überdeckt, welche
durch die Schraube e an der gußeisernen, verstellbaren,
und zugleich als Lager für den Zapfen der Walze a
dienenden Seitenwand f drehbar befestigt ist und je nach
Drehung der Flügelschraube h fest niederwärts gehalten
oder aufgedeckt werden kann. Der Backen f' von der Wand f läßt sich in einem Spalte der Schiene g verschieben, durch welche der Spannstab am Brustbaume
befestigt wird.
Fig. 17. Die
aus sechs an einander verschiebbaren gleichen Theilen bestehende hohle Walze a aus Messing mit dergleichen feinen Spitzen und
Hülsenfassungen b an beiden Enden und durchgehendem,
eisernem Zapfen c im Grundrisse.
Fig. 18. Ein
Bruchstück desselben Theiles in natürlicher Größe im Aufrisse.
Fig. 19.
Seitenansicht einer der in Fig. 17 und 18
dargestellten, die Spitzenwalze einschließenden Hülsen b, welche auf dem Zapfen durch Preßschrauben gehalten und im Innern durch eine
schiefe Ebene begränzt werden.
Fig. 20. Ein
Sechstel der mit Spitzen versehenen hohlen Messingwalze im Grundrisse. Die in den
inneren Hülsen laufenden Zapfen i aller Stäbe sind von
Eisen.
Fig. 21.
Seitenansicht der hohlen Messingwalze in ihrer Zusammensetzung aus 6 Stücken, wie
ein solches Fig.
20 zeigt.
Fig. 22.
Darstellung des Weges zweier Spitzen (wie auch aller übrigen), den sie bei ihrer
Umdrehung auf dem Walzenmantel beschreiben.
Nach der Beschreibung dieses Spannstabes in seinen einzelnen Theilen wird nunmehr
dessen Wirkungsweise leicht zu übersehen seyn. Indem das Gewebe auf der einen wie
auf der andern Sahlleistenseite mit einem etwa 3 Zoll breiten Rande durch die Rinne
d auf die Spitzenwalze aufgedrückt und diese durch
das fortrückende Gewebe gedreht wird, folgen die einzelnen Theile oder Stäbe der
Walze gleichzeitig einer zur Walzenachse parallelen Seitenverschiebung, welche einer
in den Hülsen b eingeschlossenen, ringförmigen, schiefen
Ebene als der erzeugenden Bahn entspricht. In Fig. 18 ist
beispielsweise dargestellt, wie vier Stäbe, indem sie mit ihren Enden an der durch
Punktirung verzeichneten schiefen Bahn I., II., III., IV. anliegen, bei ihrer
Drehung nach Aufwärts auch dieser Bahn – vermöge der anderseitig schiebend
wirkenden zweiten Bahn – folgen müssen und somit nach Rückwärts geschoben
werden. Die von Oben auf der Rückseite wieder herabgehenden Stäbe werden aber von
der gleichen dießseitigen Bahnhälfte wieder nach Einwärts geschoben.
Bei dem im Stuhle angeordneten Spannstabe muß nun der Weg aller das Gewebe
erfassenden Spitzen ein nach Auswärts gerichteter, der Weg aller sich wieder
lösenden und unterhalb fortlaufenden Spitzen aber ein nach Einwärts gerichteter
seyn. Fig. 22
zeigt annähernd die Spuren zweier auswärtslaufenden und somit das Gewebe spannenden
Spitzen.
Dieser Spannstab ist in Oesterreich patentirt, der Mechaniker Thumb nennt ihn mechanischen Spannstab mit excentrischer Bewegung, und
gibt davon selbst folgende Vortheile an:
1) Eine gleichmäßige continuirliche Spannung, wodurch ein genau rechtwinkeliges
Gewebe erzielt wird, und beide Enden der Tücher gerade Linien bilden, ohne daß der
Schußfaden an den Enden eine Einschnürung macht, wie bei Handspannstäben.
2) Sind weder Nadellöcher noch andere Verletzungen zu gewahren, weil die
Cylindernadeln in schiefer Richtung stehen, wodurch alles Rutschen verhindert ist;
auch wird das Tuch nie verstreckt.
3) Durch die gleichmäßige continuirliche Spannung wird an den Zettelblättern viel
erspart, indem die Zähne nicht vom Zettelfaden durchschnitten werden.
4) Bei mechanischen Webestühlen angewendet, ist ein Weber im Stande 3–4 Stühle
zu versehen, besonders wo Selbstabsteller angebracht sind.
5) Bei Anwendung auf Handwebestühlen wird die Zeit des Versetzens erspart, der
Arbeiter ist somit im Stande, mehr Gewebe zu liefern.
6) Jede Qualität wie Breite von Tüchern kann naß wie trocken gewoben werden, da die
Cylinder wie Nadeln keinen Rost erzeugen.
7) In Beziehung gegen andere mechanische Spannstäbe streckt er das Tuch von selbst
an; es braucht daher die Spannung nicht mit der Hand gegeben zu werden, wie bei
allen andern Constructionen.
8) Hält der Spannstab die Dauer eines Webestuhles aus und unterliegt keiner
Reparatur.
Durch Anwendung dieser Spannstäbe gewinnt man in jeder Hinsicht sowohl an Qualität
wie an Quantität.
Mehrere Etablissements, welche diesen Spannstab eingeführt haben, bestätigen dessen
vorzügliche Construction und erklären sich in jeder Beziehung dadurch befriedigt.
Zwar läßt schon die solide Ausführung dieser Spannstäbe, wie solche der genannte
Mechaniker liefert, auf einen guten Erfolg schließen, wohl aber dürften einige
Bemerkungen über die Anordnung dieses Tempels im Webestuhl am Platze seyn. Die
Erfahrung hat bereits gelehrt, daß es gut ist, wenn die Waare die Spitzenwalzen fast
ganz überdeckt, damit nicht die freibleibenden, äußeren Spitzenreihen den Stoff
unregelmäßig und zu sehr der Breite nach ausziehen. Ebenso ist es eine unerläßliche
Bedingung, daß die Spitzenwalzen horizontalliegend angebracht werden. Nur für dünne
Waaren dürfte es zweckmäßig seyn, den Spannrollen eine etwas nach Innen geneigte
Lage zu geben, um die ausstreckende Wirkung derselben dadurch zu modificiren. Von
dem fachverständigen Webereitechniker werden allerdings derartige Erfahrungen leicht selbst zu machen
und von seiner Empfehlung die weitere Verbreitung dieses Spannstabes abhängig
seyn.
Der Preis für einen vollständigen Thumb'schen Spannstab
ist je nach der Entfernung der Bezugsquelle zwischen 6–8 Thaler und in
Rücksicht auf die genaue Arbeit ein sehr mäßiger zu nennen. Den Hauptvertrieb damit
hat das technische Agenturgeschäft von C. Herm. Findeisen
in Chemnitz.
Tafeln