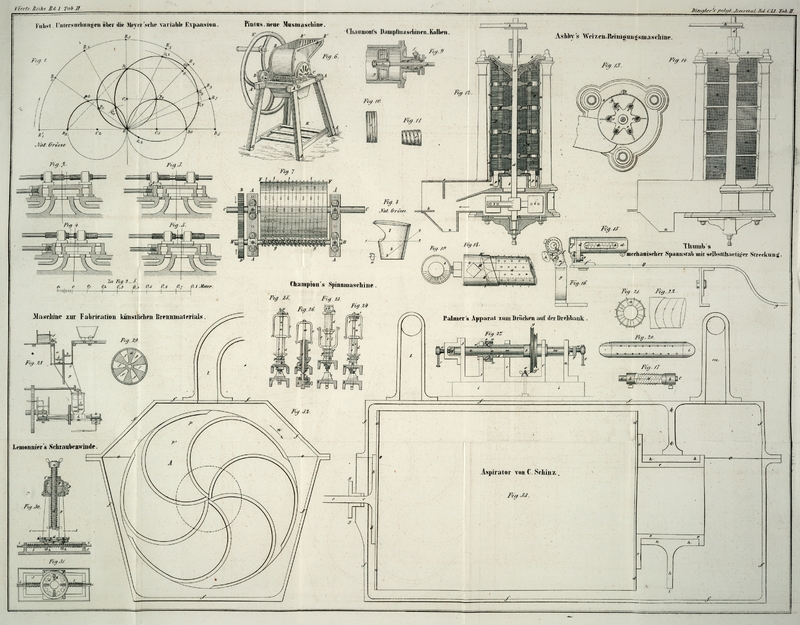| Titel: | Neue Musmaschine, nach Bentall's Patent gebaut von J. Pintus. |
| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XXVI., S. 106 |
| Download: | XML |
XXVI.
Neue Musmaschine, nach Bentall's Patent gebaut von J. Pintus.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Pintus' neue Musmaschine.
Der Zweck der hier zu beschreibenden Musmaschine ist die Zerkleinerung der
Wurzelgewächse zum Behufe der Viehfütterung. Es wird von dem Landwirthe die
Bedingung gestellt, daß die Maschine die Wurzeln (Rüben, Kartoffeln) in einen
groben Brei verwandle, ohne den Saft auszupressen; sowohl zur Fütterung als zur
Stärke- und Zuckerfabrication, gleichfalls zum Cichoriendörren, ist dieser
Zustand am entsprechendsten; bei der Fütterung soll die Saftzelle nur so weit
zerdrückt seyn, um ihren Inhalt dem saugenden Häcksel
abzutreten, ohne selbst gänzlich auszutrocknen; bei der Stärke- und
Zuckerfabrication soll dem nachfolgenden Reiben und Pressen vorgearbeitet werden, da
man gefunden hat, daß es gegen das ältere Verfahren, die Gewächse im ganzen Zustande
auf die Pressen oder Reiben zu bringen, außerordentlich vortheilhaft ist, auf einer
Vorbereitungsmaschine zuerst Halbfabricat zu arbeiten und dieses dann der
Schlußmanipulation zu unterwerfen. Bei der Stärkemühle z.B. wird durch die eben
gedachte Methode beinahe 1/3 der bisherigen Arbeitskosten erspart.
Die Aufgabe, eine allen Forderungen genügende Musmaschine zu construiren, hat Bentall
Ed. H. Bentall, Heybridge Maldon, City of Essex,
England. am vollkommensten gelöst.
Fig. 6 gibt
eine perspectivische Ansicht einer Musmaschine für Handbetrieb; Fig. 7 den inneren
Mechanismus in vergrößertem Maaßstabe. Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen
Figuren gleiche Theile.
Ein starkes Gestell von hartem Holze A, A, A, A trägt
zwei Wellen c, c H, H, welche in vier Metalllagern
laufen. Auf die Welle c, c sind zwei Kränze von Gußeisen
aufgekeilt, auf deren Oberfläche fünf gekrümmte Mantelplatten, ebenfalls gegossen,
befestigt sind, welche zusammen den Cylinder F, F,
bilden. Auf der Oberfläche dieses Cylinders ist eine Schraubenlinie gezogen und
diese mit einer großen (beliebigen) Anzahl von Löchern besetzt, welche zur Aufnahme
der kleinen Messer I, I, I.... dienen. Diese Messer, von
denen Fig. 8
ein einzelnes a in verhältnißmäßiger, b in natürlicher Größe zeigt, sind aus bestem Gußstahl
gestanzt und gehärtet bis zur Gränze des Gelb und Blau. Die Löcher in den
Cylinderplatten sind ebenso conisch wie die Messer, haben eine genügende Weite, um
sie bis 1–2 eintreiben zu können und sind nach der auf 1–2 senkrecht
stehenden Richtung 3–4 noch luftig genug um das Eintreiben eines Holzkeils
gestatten zu können. Es leuchtet ein, daß das Herausnehmen der Messer durch einige
Schläge mit einem kleinen Hammer bewirkt werden kann, selbst ohne eine Platte
abzunehmen – ein Umstand, der von denen gewürdigt werden wird, welche andere
Zerkleinerer benutzen und die Schwierigkeiten der Reparaturen auf dem Lande
kennen.
Die so auf dem Cylindermantel befestigten, hakenförmig hervorragenden Messer greifen
nun in die Gewinde der endlosen Schraube g, g welche
sich auf der Spindel H, H befindet. Cylinder und
Schraube sind durch die Zahnräder D, D' verbunden. Ueber
dem Cylinder steht der gußeiserne Zuführtrichter B, B, B',
B', dessen hintere Wand, rostförmig durchbrochen, Erde, Schmutz, kleine
Steinchen etc. durchfallen läßt, während die vordere Wand B,
B etwas ausgebaucht ist, um den Zähnen das Ergreifen der Früchte zu
erleichtern. Diese vordere Wand reicht eben bis auf die Hälfte der Schraube g, g hinunter, und es erhellt nun wohl, daß die von den
Zähnen abgerissenen Stücke, durch die Drehung nach der von den Pfeilen angedeuteten
Richtung gezwungen, zwischen den Windungen der Schrauben aufgequetscht werden
müssen. Das so bereitete grobe Mus fällt bei weiterer Umdrehung in die auf dem
Untersatz K befindlichen beliebigen Gefäße oder in einen
Trog mit Beförderungsschnecke, welche eventuell die Masse den Pressen oder Reiben
zuführt. An der Welle c befindet sich das Schwungrad E entweder mit Kurbel oder Riemenscheibe, je nach der
Größe der Maschine und Art des Betriebes.
Die kleinste Art der Musmaschine, zum Betriebe durch einen Mann, liefert ohne
besondere Ueberanstrengung desselben pro Arbeitsstunde
das Mus von 12 preuß. Schäffeln Rüben oder 16 Schäffeln Kartoffeln. Von dieser Größe
sind im Laufe des Jahres 1858 mehr als hundert Exemplare in Deutschland in Betrieb
gesetzt. Bentall's Nummer reicht seit zwei Jahren bereits
an 4000. Die größeren Dimensionen, für Roßwerts- und Dampfbetrieb können bis
zu 300 Umdrehungen pro Minute betrieben werden und
vermusen in der Arbeitsstunde 50–70 Schäffel Früchte.
Brandenburg a. b. Havel.
Tafeln