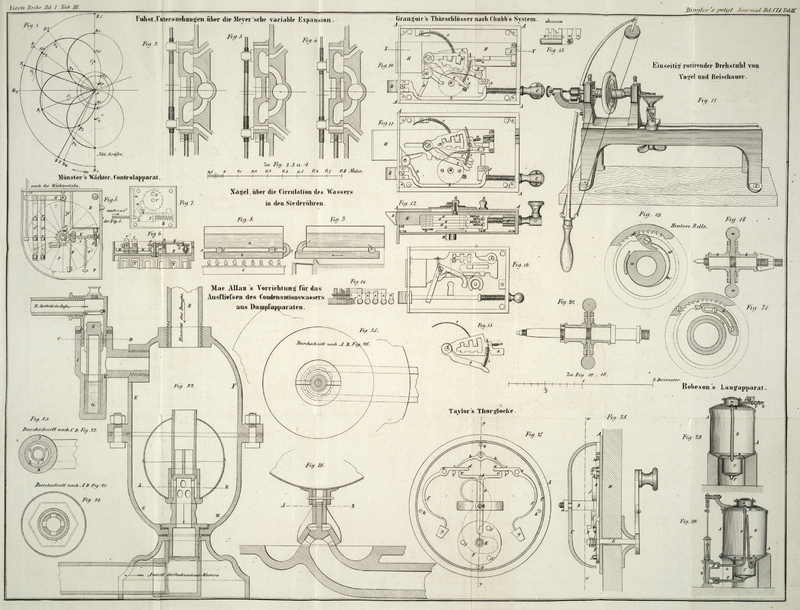| Titel: | A. E. Taylor's Thorglocke. |
| Fundstelle: | Band 151, Jahrgang 1859, Nr. XLIV., S. 186 |
| Download: | XML |
XLIV.
A. E. Taylor's
Thorglocke.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Taylor's Thorglocke.
Es wird wohl wenige Leute geben, die nicht schon in Verlegenheit gekommen sind, wenn
sie irgendwo an der Glocke eines fremden Hauses zogen, und dieselbe gab entweder gar
keinen hörbaren Laut, oder verursachte ein solches Geräusch, daß man unwillkürlich
aus Sturmläuten erinnert wird; – aber auch die Bewohner des Hauses haben
unter dieser Unbequemlichkeit zu leiden, denn im ersten Falle muß der vielleicht
willkommene Besucher lange an der Thüre stehen und warten, und im zweiten Fall wird
Jedermann im Hause durch das Geläute erschreckt.
Die hier zu beschreibende Vorrichtung hat den Zweck, diese Schwierigkeit zu
überwinden und eine Thorglocke darzubieten, welche immer und ganz sicher den
gewünschten Laut von. sich gibt, wobei es ganz in der Macht des Läutenden steht, den
Laut zu verstärken oder zu verlängern. Das Läuten geschieht durch Drehen einer
Kurbel, und die Erfindung besteht darin, daß eine mit Hebedaumen versehene Platte
auf einen Anker wirkt, welcher mit zwei unter einer Glocke angebrachten Hämmern so
in Verbindung gesetzt ist, daß durch Umdrehen der Scheibe die Hämmer gehoben und
durch passend angebrachte Federn gegen die Glocke getrieben werden.
Fig. 27 ist
ein verticaler Durchschnitt dieser Vorrichtung, wobei die Linie xx in Fig. 28 die Richtung des
Schnittes andeutet; Fig. 28 ist ein verticaler Durchschnitt derselben nach der Linie yy in Fig. 27.
Die gleichen Buchstaben bezeichnen in beiden Figuren dieselben Theile der
Vorrichtung.
A ist eine Metallplatte von Messing oder Eisenguß mit
einem Ständer B in der Mitte, auf welchem mittelst einer
Schraubenmutter a eine Glocke C befestigt werden kann. Ein Anker D liegt
flach auf der Platte und ist um den Zapfen b drehbar.
Das untere Ende des Ankers ist abgebogen und erstreckt sich über eine Platte F, welche auf einer durch den Untertheil der Platte sich
erstreckenden, in ein Viereck auslaufenden Achse E
steckt. Die Platte A wird an einem passenden Platze im
Innern des Hauses mittelst der Schrauben K, K, K, K an
einem Pfosten H befestigt und die Achse E erstreckt sich durch den Pfosten nach Außen und trägt
dort eine Kurbel G. Auf der Oberfläche der Platte F ist eine Anzahl Hebedaumen j,
j, j befestigt, welche beim Drehen der Platte auf das untere Ende des
Ankers wirken. Das obere Ende des Ankers läuft in zwei Enden c, c aus und die um Zapfen e, e drehbaren Arme
d, d werden durch eine flache Feder h, h abwärts gedrückt und durch Stellstifte i, i in solcher Stellung gehalten, daß sie mit ihrem
Ende gerade oder den Vorsprüngen c, c des Ankers stehen.
Die Arme d, d laufen in flache gebogene Federn f, f aus, welche an den Enden die Hämmer g, g tragen; die Federn f, f
sind so gebogen, daß im Ruhestand die Hämmer g, g von
dem innern Umfang der Glocke abstehen; wenn aber die Arme d,
d gehoben und schnell herabgelassen werden, so werden die Hämmer gegen die
Glocke getrieben und geben je einen scharfen Laut. Sobald
daher die Scheibe F mittelst der Kurbel G in einer oder der andern Richtung gedreht wird, wird
das untere Ende des Ankers D durch einen der Hebedaumen
j, j, j nach einer oder der andern Seite hin
getrieben, und einer der Vorsprünge c hebt den einen Arm
d auf und zieht dadurch den entsprechenden Hammer g zurück. Bei fortgesetzter Drehung der Platte F wird das untere Ende des Ankers wieder von dem
Hebedaumen frei, und der Arm d wird durch die Wirkung
der Feder h mit ziemlicher Gewalt herabgetrieben, so daß
der entsprechende Hammer g gegen die Glocke schlägt, und
einen Laut von sich gibt.
Es ist leicht einzusehen, wie durch das Drehen in einer Richtung der eine, und durch
das Drehen in der andern Richtung der andere Hammer in Thätigkeit gesetzt wird, und
da die Drehung der Platte F nach beiden Seiten mit
gleicher Leichtigkeit geschieht, so wird durch diese Vorrichtung auch der mit
mechanischen Vorrichtungen gänzlich Unbekannte nicht in Verlegenheit kommen, wenn er
nur weiß daß er drehen und nicht ziehen muß.
Die Anzahl der Schläge hängt von der Dauer der Drehung und von der Anzahl der auf der
Platte F angebrachten Hebedaumen ab, und es wäre ein
Leichtes, durch die Anzahl der Schläge den Bewohnern der verschiedenen Stockwerke
eines Hauses anzuzeigen, wer einen Besuch zu erwarten hat, und wenn es gewünscht
würde die Glocke von der Hausthüre entfernt anzubringen, so kann man die Vorsprünge
c, c durch Drähte mit den Armen d, d in Verbindung setzen, wobei es jedoch nöthig wäre,
passend angebrachte Winkelhebel auf die Arme wirken zu lassen, so daß ein Sinken des
Vorsprungs c dennoch ein Heben des entsprechenden Armes
d zur Folge hätte. Im Allgemeinen jedoch wird der
Ton einer Glocke, wie sie in der Zeichnung angedeutet ist, laut genug seyn, um
durchs ganze Haus gehört zu werden, namentlich da die Größe der Glocke ganz
willkürlich ist, vorausgesetzt, daß sie zu der hier beschriebenen Einrichtung
paßt.
Diese Art von Thorglocken ist die Erfindung des Hrn. N. E. Taylor von Troy im Staate New-York und wurde demselben in den
Vereinigten Staaten patentirt.
W. Hauff in New-York.
Tafeln