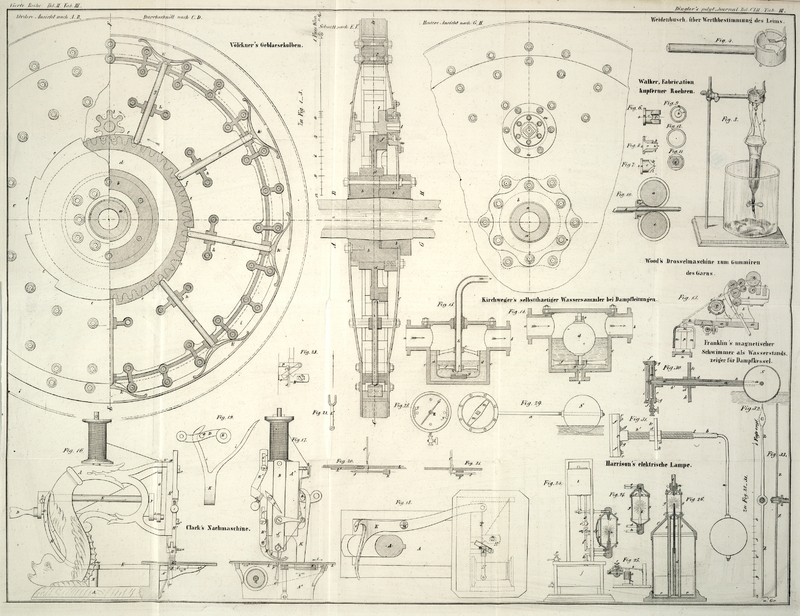| Titel: | Selbstthätiger Wassersammler bei Dampfleitungen; vom Maschinen-Director Kirchweger in Hannover. |
| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. XXXV., S. 163 |
| Download: | XML |
XXXV.
Selbstthätiger Wassersammler bei Dampfleitungen;
vom Maschinen-Director Kirchweger in Hannover.
Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,
1859 S. 34.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Kirchweger's selbstthätiger Wassersammler bei
Dampfleitungen.
Bei langen Dampfleitungen findet sich in Folge der Abkühlung stets etwas condensirtes
Wasser, welches von dem Dampfstrome fortgerissen in die Arbeitsmaschine gelangt und
hier zerstörende Wirkung veranlassen kann. Um diesem Uebel entgegenzuwirken, bringt
man in der Rohrleitung an entsprechender Stelle einen Wassersammelkasten an, in
welchem jenes Wasser sich anzusammeln Gelegenheit findet; ist das Gefäß gefüllt, so
muß es entleert werden, und damit dieß von selbst geschehe, hat man folgende
Einrichtungen getroffen.
Fig. 14. In
der Dampfleitungsröhre a, b ist das Sammelgefäß c, c eingeschaltet; innerhalb dieses ist eine hohle
Kugel d von Messing- oder Kupferblech angebracht,
welche mit entsprechenden Leitungsstiften in den Führungen e,
f gehalten, sich nur auf und nieder bewegen kann. Der untere Leitungsstift
endet bei g in ein kleines Kegelventil, welches die
Abflußrohre h verschließt, sobald die Kugel mit ihrem
Gewichte frei niederdrückt. Sammelt sich nun in dem Gefäße ein gewisses
Wasserquantum, so daß darin die Kugel d schwimmt, so
wird das Ventil g gehoben und der Wasserausfluß durch
h gestattet, bis der Wasserspiegel und zugleich die
schwimmende Kugel so weit gesunken sind, daß das Ventil g die Oeffnung h wieder verschließt.
Fig. 15
stellt einen ähnlichen Apparat dar, welcher von dem vorigen nur insofern abweicht,
als anstatt dort d eine hohle Kugel, hier d, d ein nach Oben offenes Gefäß ist, welches auf seiner
innern Bodenfläche bei g ein Stückchen vulcanisirtes
Gummi-elasticum trägt, durch welches letztere die Oeffnung des Rohres h wasserdicht verschlossen wird, sobald das Gefäß d, d von dem zwischen den Wänden c, d, d, c befindlichen Wasser schwimmend getragen wird. Bei einer
gewissen Ansammlung von condensirtem Wasser wird auch das Gefäß d, d gefüllt, und zwar so weit, bis dasselbe sinkt und
dadurch die untere Oeffnung des Rohres h frei wird. Der
Druck des Dampfes auf die Wasserfläche veranlaßt das Ausströmen des Wassers durch
das Rohr h so lange, bis das Gefäß erleichtert
emportreibt und die
Gummiplatte die Oeffnung wieder verschließt. Die Dimension eines solchen
Sammelgefäßes ist etwa 10–12 Zoll Höhe bei eben solchem Durchmesser.
Tafeln