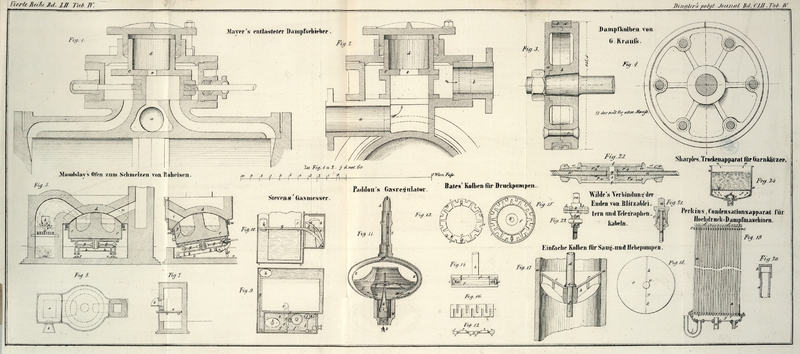| Titel: | Patentirte Maischmaschine von J. S. Schwalbe und Sohn in Chemnitz; beschrieben von Gustav Willkomm. |
| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. XC., S. 343 |
| Download: | XML |
XC.
Patentirte Maischmaschine von J. S. Schwalbe und Sohn in Chemnitz; beschrieben von Gustav Willkomm.
Aus dem polytechnischen Centralblatt, 1859 S.
417.
Mit einer Abbildung auf Tab. IV.
Schwalbe's Maischmaschine.
Ein wesentliches Bedürfniß für Brauereien von solcher Größe, welche die in der
Neuzeit errichteten erhalten haben, ist eine Maschine, welche den Brauern die
anstrengende Arbeit des Einmaischens abnimmt. Da das Maischen den Zweck hat, die im
Wasser löslichen Bestandtheile des Malzes durch Wasser aufzulösen, so muß zur
schnellen Beendigung des Vorgangs Malz mit Wasser in innige Berührung gebracht und
einige Zeit darin erhalten werden. Der Zweck der Maischmaschine besteht daher darin,
eine continuirlich kräftige Bewegung der Maische im Bottich herbeizuführen. Dieß
geschieht bei der oben genannten, die in einem monodimetrischen Durchschnitt in Fig. 1
dargestellt ist, in folgender Weise: Durch eine Stopfbüchse im Boden des
Maischbottichs B, B geht die Triebwelle A, auf welcher die Träger D,
D' der Rührapparate C, C' durch Keile befestigt
sind, so daß sie sich mit ihr umdrehen. A erhält seine
Bewegung durch zwei conische Räder unterhalb des Bottichs von der Transmission aus.
Auf dem oberen Rande des Bottichs sitzt ein sechsarmiges Gerüst E fest, welches der Welle A
als Halslager dient und auf seinem inneren Theile das Stirnrad F trägt, das durch Keil- und Preßschraube auf ihm
befestigt ist. Mit dem Rade F steht das kleinere, auf
der Welle L sitzende Stirnrad H in Eingriff. Die Welle J, welche die
Rührkreuze C trägt, hängt an den Armen D, D₁ und wird durch das conische Rad M umgedreht; dieses wälzt sich nämlich bei der Rotation
der Achse A und der an dieser befestigten Arme D, D¹ auf dem am Lager N befestigten Rade Q, ebenso wie das Getriebe
H auf dem Stirnrad F.
Dreht sich nun A in der durch den Pfeil angedeuteten
Richtung, so werden auch D, D₁ in derselben
Richtung bewegt, und dabei wälzt sich das Getriebe H an dem festen
Rade F fort, so daß eine Umdrehung von C um die Achse L nach der in
der Abbildung bezeichneten Richtung eingeleitet wird, und eben so wälzt sich M auf Q und veranlaßt zu
derselben Zeit eine Umdrehung von C₁ um die Achse
J. Zwei nahe am Boden hängende Flügel S, S rühren bei der Umdrehung von L die Masse auf, welche sich am Boden abgesetzt hat. Durch die Rotation
sämmtlicher Apparate, sowohl um die gemeinschaftliche Achse, als um ihre eigenen
Achsen, wird die Masse im Bottich gleichmäßig und vollständig in Bewegung gesetzt
und Malz mit Wasser gut gemischt.Hiermit ist zugleich die größtmögliche Nutzung des Malzes verbunden. Bei der
bereits seit drei Monaten im Gange befindlichen Patentmaschine auf der
Actienlagerbierbrauerei zu Chemnitz hat sich gegen die Erfahrung an älteren
Maschinen ein Minderverbrauch an Malz von 4 bis 5 Ctnr. auf einen Sud von 96
Eimern Bier ergeben.
Hiernach unterscheidet sich nächst größerer Stabilität die eben beschriebene Maschine
von den bisher angewendeten Maischmaschinen ähnlicher Construction dadurch:
1) Daß bei ersterer ein horizontaler und ein verticaler Rührer während der ganzen
Zeit des Maischens eine constante Geschwindigkeit haben, bei letzteren hingegen
diese beiden Rührer – die eigentlich arbeitenden wirksamen Theile der
Maschine – nur beim Beginn des Betriebs sich mit constanter Geschwindigkeit
bewegen, später aber mit der zunehmenden Geschwindigkeit der in Rotation kommenden
Maische immer langsamer umgehen, bis die kreisförmig circulirende Maische ihre
Maximalgeschwindigkeit erreicht hat und die Rührer ganz stehen bleiben; während der
übrigen Zeit des Maischens bewegen sie sich nur periodisch mit einer von der
Geschwindigkeit der bewegten Maische abhängigen Umdrehungszahl.
2) Daß bei der Patentmaschine die beiden Rührer nicht wie bei den bisher üblichen in
einer und derselben Bewegungsrichtung, sondern gegen einander arbeiten, folglich
auch der Maische eine weniger im Kreise als eine mehr in und durch einander gehende
Bewegung ertheilen. Die bisher angewendeten Maischmaschinen erfordern ihrer
bestehenden Einrichtung nach eine Rotation der Maische, um die davon abhängige
Umdrehung des auf der stehenden Welle lose sich drehenden
Hebels oder Trägers, an welchem die beiden Rührer ihre Lagerung haben, zu
bewirken.
Um die Bewegung der Rührer bei den bisher gebräuchlichen Maischmaschinen etwas
bestimmter zu veranschaulichen, sey noch bemerkt, daß hier das Stirnrad F fest auf die stehende Welle gekeilt ist, eben so wie
das conische Rad Q; daß ferner der Träger D, D' nicht fest, sondern lose auf der stehenden Welle
steckt, und daß endlich zwischen den beiden Stirnrädern
F und H noch ein
Transporteur eingeschaltet ist. Bei Ingangsetzung dieser Maschine dreht sich
zunächst die stehende Welle auf den darauf befestigten Rädern und bringt die beiden
Rührer in Bewegung um ihre eigenen Achsen. Durch die Umdrehung der letzteren kommt
die Maische in eine kreisförmige Bewegung; durch die bewegte Maische wird allmählich
der Träger D mitgenommen, bis derselbe die
Geschwindigkeit der stehenden Welle erreicht und somit die beiden Rührer in
Stillstand versetzt werden. Nimmt die Geschwindigkeit der beweglichen Maische ab, so
bewegen sich die Rührer wieder ein wenig, und so arbeitet die Maschine periodisch
weiter bis zum Ende des Maischens.
Tafeln