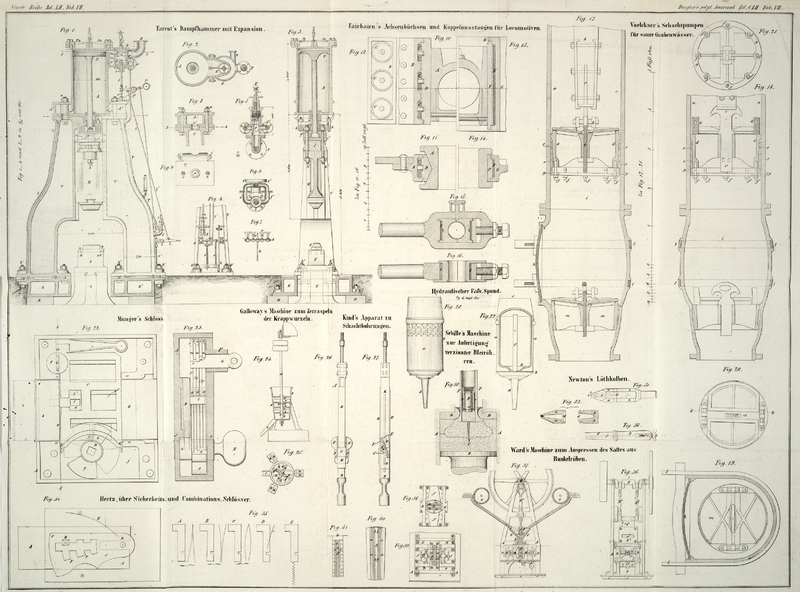| Titel: | Ueber Schachtpumpen für saure Grubenwässer; von C. Völckner, Maschinen-Inspector zu Reichenberg in Böhmen. |
| Autor: | C. Völckner |
| Fundstelle: | Band 152, Jahrgang 1859, Nr. CIV., S. 401 |
| Download: | XML |
CIV.
Ueber Schachtpumpen für saure Grubenwässer; von
C. Völckner,
Maschinen-Inspector zu Reichenberg in Böhmen.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Völckner, über Schachtpumpen für saure Grubenwässer.
Die corrosiven Eigenschaften der sauren Grubenwässer machen den Schachtpumpenbetrieb
im Allgemeinen kostspielig und verursachen häufige Arbeitsstörungen, da dieselben
vorzüglich die arbeitenden, gleitenden und reibenden Theile, welche weder durch
einen Anstrich, noch durch Verzinken etc. zu schützen sind, angreifen und dadurch
Brüche oder Undichtigkeiten herbeiführen. Bei Plungerpumpen schützt man sich durch
Umhüllung des Plunger mit Bronze und durch Anwendung von Stopfbüchsen aus Bronze,
und bei Hubsätzen durch Ausfüllung der Cylinder und Anfertigung der Kolben und
Ventile aus derselben Legirung. Der Bau derartiger Pumpen ist jedoch nicht nur sehr
theuer, sondern auch ein nicht immer zweckentsprechender, da bei der Reibung von
Bronze auf Bronze in sandführenden Wässern sich feiner Sand zwischen die gleitenden
Flächen setzt, dieselben mechanisch zerstört und außerordentliche Kraft, häufig bis
zur Unbeweglichkeit, absorbirt. Bei Hubpumpen mit Lederliederungen muß, da sich das
Leder an den bald rauhen Cylinderwänden schnell zerreibt, häufiges Auswechseln
derselben stattfinden, was, abgesehen von den Störungen, den Betrieb außerordentlich
vertheuert.
Mit allen angedeuteten Uebelständen vertraut, construirte ich nun für eine
Braunkohlengrube, in welcher pro Minute 220 Kubikfuß
sehr saure Wässer zu wältigen waren, Pumpen, bei welchen die Anwendung des Leders
vollständig beseitigt ist und die sich seit längerer Zeit so bewährten, daß ich die
Nachahmung derselben, vorzüglich der Kolbenconstruction, welche vollständig neu seyn
dürfte, nur empfehlen kann.
Fig.
17–21 zeigen in fünf verschiedenen Ansichten eine Pumpe dieser
Construction.
a ist der abgebrochen gezeichnete Cylinder von 22 Zoll
Durchmesser, aus feinem halbirten Eisen gegossen, und zwar so dicht, daß derselbe
nur eben noch zu
bohren ist; es ist dieß eine Hauptsache, da das Gußeisen, je feiner und dichter,
desto besser den corrosiven Wässern widersteht.
b ist das hölzerne Gestänge, am untern Ende geschlitzt
und über das sogenannte Kolbenschwert c geschoben. Zu
beiden Seiten des hölzernen Gestängeendes liegen Schienen, welche mit einem
winkelrecht angesetzten Haken die Platte des Kolbenschwertes umfassen, um beim Heben
der Wassersäule die Last gleichmäßiger zu vertheilen.
d ist der gußeiserne Kolbenkorper, aus gleichem Eisen
wie der Cylinder gegossen und auf seiner äußeren Fläche conisch abgedreht und zwar
nach Unten verjüngt. Das Kolbenschwert tritt flach durch den Körper, ist mit zwei
Keilen festgezogen und verbreitet sich, wie in Fig. 18 zu sehen, auf
beiden Seiten in zwei starke sichelförmige Nothhaken, um bei einem Gestängebruch den
Kolben mittelst Kette aus dem Cylinder ziehen zu können, welcher um circa 1 Zoll enger ist als die Aufsatzröhren.
Ueber den Kolbenkörper d, welcher an seinem oberen Ende
20 1/4 Zoll, an seinem unteren Ende 21 1/4 Zoll Durchmesser hat, sind vier bronzene,
nach gleicher Conicität ausgebohrte Ringe e, e, e, e
geschoben, welche mit Nuth und Feder in einander schließen und nach dem
Zusammenschleifen aufgeschnitten sind.
Fig. 21 zeigt
den Kolben von Unten gesehen. – Die acht in den Kolbenkörper eingesetzten
Schrauben f, f, f... halten den Ring g fest, der einen etwas geringern Durchmesser als der
Cylinder hat, und an welchen sich die Ringe e
anlegen.
Zweck des Ringes g ist, mittelst der Schrauben f die Liederungsringe e
empor zu drücken, welche expandirend, sich gegen die Cylinderwand dichtend anlegen.
Soll der Kolben nachgedichtet werden, so stellt man denselben auf den tiefsten Hub,
öffnet die Thür h des Ventilgehäuses i, welche aus Kesselblech besteht, und vermag nun leicht
zum Anziehen der Muttern zu kommen. Es ist diese Operation in kurzer Zeit
ausgeführt; wogegen bei einer Lederliederung der Kolben in den Ventilkasten
herabgelassen und vom Gestänge, häufig mit großer Mühe, entfernt werden muß –
eine oft Stunden dauernde Arbeit.
Sind die Ringe so weit hochgeschraubt, daß der oberste gegen den Ansatz des
Kolbenkörpers tritt, so wird derselbe entfernt und zwischen dem untersten Ring e und dem Spannring g ein
neuer eingesetzt. g kommt dadurch wieder auf seinen
ersten Sitz zurück.
Auf dem Kolbenkörper befinden sich die schrägen Sitzflächen für die Ventilklappen,
welche sich in steigenden Scharnieren bewegen.
k sind Stühlchen von Bronze, neben den Klappen
aufgeschraubt, welche den Zapfen der Ventilklappen ein Steigen von 1 1/2 Zoll
gestatten, dadurch ein
Klemmen und Festsetzen verhüten und eine außerordentlich große Durchgangsöffnung
bilden.
Der Hub der Zapfen in k wird durch Vorsteckfeile
begränzt, welche bei einer Reparatur etc. leicht zu entfernen sind. Die Anwendung
dieser steigenden Scharniere ist von bedeutender Wichtigkeit bei so großen Klappen;
denn setzt sich auf der Fläche zwischen den Drehpunkten der Klappen Sand oder irgend
ein anderer fremder Körper fest, so brechen beim Niedergehen des Ventils, durch die
bedeutende Hebelkraft, die Zapfen weg, oder verbiegen sich derart, daß ein Schließen
unmöglich ist.
i ist das Ventilgehäuse, tonnenförmig ausgebaucht und
durch die Thür h geschlossen. Um dasselbe liegen zwei
Bänder l, l von Flacheisen, welche vor der Thür durch
zwei Balken zusammengehalten sind. Durch hölzerne Keile, welche zwischen Balken und
Thür eingetrieben werden, wird letztere festgehalten und zur Dichtung dient eine
gewöhnliche Hanfflechte. Das Oeffnen und Schließen der Thür ist hierdurch leicht und
schnell zu bewerkstelligen, wogegen bei Schraubenverschluß und gußeisernen Thüren in
engem Schachte diese Arbeit nicht nur zeitraubend ist, sondern auch durch
ungleichmäßiges Anziehen der gußeisernen Flantschen häufig die Ventilkasten oder
Thüren gesprengt werden, und dadurch leicht eine Arbeitseinstellung, resp. Ersaufen
des Schachtes, herbeigeführt werden kann.
m ist das Saugventil, hinsichtlich der Klappen von
gleicher Construction wie der Kolben. Dasselbe ist ebenfalls mit Schwert und
Nothhaken versehen, um es bei ersoffenem Schachte, wenn der Satz ausgebaut werden
soll, vermittelst einer Kette herausreißen zu können.
Der Querschnitt des Kolbens ist bei 22 Zoll Durchmesser = 11² × 3,14 =
380,13 und die freie Oeffnung des Ventiles = 171 Quadratzoll, also 45 Proc.
desselben.
Tafeln