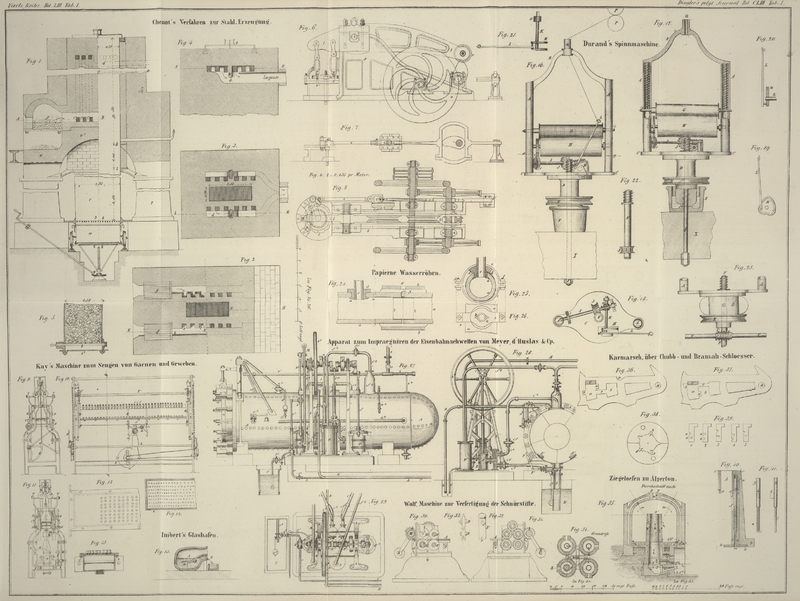| Titel: | Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen, von Meyer, D'Huslar und Comp. |
| Fundstelle: | Band 153, Jahrgang 1859, Nr. IV., S. 12 |
| Download: | XML |
IV.
Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen,
von Meyer, D'Huslar und Comp.
Aus Armengaud's Génie industriel, Novbr. 1858, S.
257.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Meyer's Apparat zum Imprägniren der Eisenbahnschwellen.
Der Apparat von Meyer, D'Huslar und Comp. zum Imprägniren
der Hölzer im Großen auf möglichst billigem und raschem Wege, eignet sich
hauptsächlich für die Längs- und Querschwellen der Eisenbahnen. Zu dem Ende
bringt man eine Anzahl Schwellen in metallene Gefäße, die einen starken Druck
aushalten und ganz dicht verschlossen werden können. Darauf wird das Gefäß luftleer
gemacht und hernach Dampf eingelassen, der so lange darin bleibt, daß die Holzfasern
gehörig erweicht werden. Dieser Dampf wird dann durch raschen und reichlichen Aufguß
von kaltem Wasser auf die äußere Wand des metallenen Gefäßes verdichtet. Nachdem das
Condensationswasser nun aus dem Gefäße abgelassen worden ist, erzeugt man wiederum
einen luftverdünnten Raum, um die mit Dampf gesättigte Luft, welche zwischen die
Holzfasern eingedrungen seyn könnte, auszuziehen. Zuletzt wird die
Imprägnirungsflüssigkeit eingespritzt und zwar unter einem Druck von 8 bis 10
Atmosphären, damit sie möglichst tief in die erweichten Holzfasern eindringt. Als
Imprägnirungsflüssigkeit dient hierbei Kupfervitriol oder Eisenvitriol.
Fig. 27 ist
der Längenaufriß dieses Apparats;
Fig. 28 ist
ein Querdurchschnitt nach der Achse der Imprägnirungspumpen;
Fig. 29 ist
der Grundriß ohne die Pumpen.
Der große, aus zusammengenieteten Blechen bestehende Cylinder A ist an dem einen Ende durch eine aufgenietete halbkugelförmige Haube
geschlossen; das andere Ende, das nach Bedarf geöffnet werden kann, wird durch einen gußeisernen Deckel
a dicht verschlossen, der zu seiner bequemeren
Handhabung an einem krahnartigen, auf dem Blechcylinder befestigten Gestelle a² aufgehängt ist und vermittelst der Bügel a mit Schrauben gegen den Cylinder angedrückt wird. Im
Innern des Cylinders befinden sich zwei Schienen zum Transport der Wagen, auf
welchen die zu imprägnirenden Hölzer aufgeladen sind und die, nachdem diese Hölzer
in den Cylinder abgelegt sind, wieder zurückgefahren werden, worauf der Deckel a dicht aufgeschraubt wird.
In der Nähe des Blechgefäßes A steht ein Dampfcylinder
B, der seinen Betriebsdampf durch die Dampfleitung
b¹ erhält. Die Bewegung, welche in diesem
Dampfcylinder erzeugt wird, wird den Luftpumpen F und
F¹, die den luftverdünnten Raum im Gefäße
herstellen, mitgetheilt. Diese Luftpumpen können durch Eröffnung eines Hahns f³ in der Leitung f² mit einem Recipienten f⁴ und dem
Blechgefäße nach Bedürfniß in Verbindung gesetzt werden.
Nach Herstellung des luftverdünnten Raums im Blechgefäße A wird der Absperrungshahn b¹⁰
in der Dampfleitung b⁹ hinter dem Schieberlasten
b⁵ geschlossen, und dadurch die Verbindung
zwischen dem Dampfcylinder und dem Dampfkessel unterbrochen. Dagegen eröffnet man
nun die mit dem Dampfkessel communicirende Rohrleitung D, aus der von jetzt an der Dampf durch die beiden Zweigrohre d' in das Gefäß A einströmt.
Der Dampf erfüllt das Blechgefäß A und sammelt sich
darin so weit an, daß er eine gewisse Spannung erreicht, deren Größe durch das mit
dem Blechgefäß in unmittelbarer Verbindung stehende Manometer a³ erkannt wird. Ist die Spannung bis auf den gewünschten Grad
gestiegen, so wird der Hahn in der Dampfleitung D
geschlossen, und die zu imprägnirenden Hölzer bleiben so lange der Einwirkung des
gespannten Dampfes ausgesetzt, als es die Erfahrung und die Beschaffenheit des
Holzes vorschreibt. Der Zweck dieser Operation ist eine durchgängige Erweichung
aller Holzfasern.
Hierauf muß der Dampf condensirt werden. Zu diesem Zweck setzt man einen Behälter mit
kaltem Wasser durch eine Rohrleitung e mit einem über
die ganze Länge des Gefäßes sich erstreckenden Rohre e¹, das an dem unteren Theile seiner Umfläche mit vielen feinen Löchern
durchbohrt ist, in Verbindung. Durch die kleinen Oeffnungen strömt das Wasser in
Form eines Regens über die Wand des Blechgefäßes aus und condensirt dadurch den in
dem Gefäß befindlichen Dampf. Dann öffnet man einen oben am Blechgefäße angesetzten
Hahn a⁶, um das Innere des Gefäßes mit der
atmosphärischen Luft in Communication zu setzen, die den etwa noch vorhandenen Dampf
niederschlägt und das Ausfließen des Condensationswassers durch den unten am Kessel
befindlichen Hahn a⁷ gestattet. Mit diesem Wasser
entweicht zugleich der noch vorhandene Dampf, theils durch den unteren Hahn a⁷, theils durch den oberen a⁶. Die Hölzer haben nun einen schwammigen
Zustand angenommen und sind frei von Saft und allen fremden Bestandtheilen, die dem
Einbringen der Imprägnirungsflüssigkeit ein Hemmniß entgegensetzen könnten.
Sodann werden die Hähne a⁶ und a⁷, sowie der Hahn in der Rohrleitung e geschlossen, und dagegen der Hahn f³ der Luftpumpen wieder geöffnet. Der
Dampfcylinder B wird wieder in Thätigkeit gesetzt, und
von neuem ein luftverdünnter Raum in dem Gefäße A
erzeugt. Nach Beendigung dieser Operation durch Schließen der Hähne f³ und b¹⁰ öffnet man den Schieber g,
welcher das in das Reservoir H der
Imprägnirungsflüssigkeit einmündende Rohr G bisher dicht
abgeschlossen hat. Da mm das Rohr G mit dem Gefäße A in Verbindung steht, in diesem aber die Spannung weit
unter den atmosphärischen Druck herabgezogen ist, so strömt die
Imprägnirungsflüssigkeit in das Gefäß nach und füllt dasselbe bis zu einer gewissen
Höhe, die man an dem Wasserstandsglas a⁴
beobachtet. Während man den Schieber g vermittelst der
durch eine Stopfbüchse geführten Stange g¹
schließt, öffnet man gleichzeitig den Hahn a⁶ und
darauf den Hahn i⁶, wodurch die Druckpumpen I und I¹ mit dem
Behälter H in Verbindung gesetzt werden. Diese Pumpen
drücken die Imprägnirungsflüssigkeit durch das Rohr i⁴ mit dem geöffneten Hahne i⁵ in
das Gefäß A, so daß der Spiegel in demselben höher
steigt, als er durch das bloße Ansaugen erlangt werden konnte. Man unterbricht nun
das Spiel der Druckpumpen I und I¹, schließt die Hähne i⁵ und
a⁶ und setzt die Compressionsluftpumpe in
Thätigkeit, wodurch die in dem Gefäße A befindliche Luft
bis zu 8 bis 10 Atmosphären Druck comprimirt wird. a⁵ ist ein Sicherheitsventil.
Die Imprägnirungsflüssigkeit durchdringt unter diesem Drucke rasch die erweichten
Fasern, und hat die Einwirkung lange genug gedauert, so öffnet man den Hahn a⁶ und den Schieber g, worauf die comprimirte Luft durch a⁶
entweicht und die Imprägnirungsflüssigkeit durch G nach
dem Behälter H zurückfließt. Der Cylinder wird geöffnet
und entleert.
Tafeln