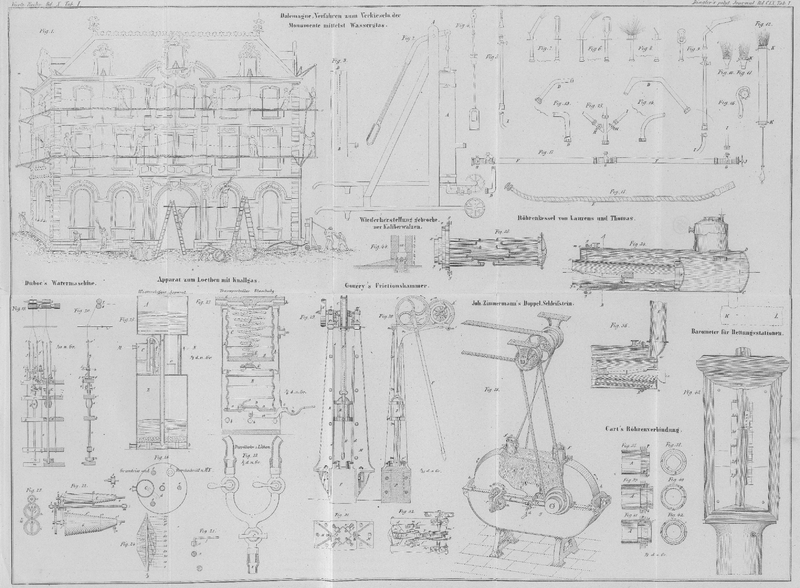| Titel: | Ueber Löthen mit Knallgas; von Otto Siebdrat. |
| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XII., S. 27 |
| Download: | XML |
XII.
Ueber Löthen mit Knallgas; von Otto Siebdrat.
Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1861,
Nr. 10.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Siebdrat, über Löthen mit Knallgas.
Da das Löthen mit Knallgas, vorzüglich für Bleilöthungen und solche mit Hartloth,
eine immer größere Anwendung findet, so soll im Folgenden die Beschreibung dieses
Verfahrens und der dazu nöthigen Apparate gegeben werden.
Die Apparate beschränken sich auf ein transportables Gefäß zur Erzeugung des
Wasserstoffgases (Fig. 25 und 26) und auf einen
ebenfalls transportablen Blasebalg (Fig. 27), der dem
Wasserstoffgas den zur Knallgasbildung nöthigen Sauerstoff aus der Luft zuführt. Von
jedem dieser Apparate führt ein beliebig langes Gummirohr die beiden Gase in einem
Doppelhahn (Fig.
28) zusammen, von welchem sie dann als Knallgas in einem
gemeinschaftlichen Gummischlauch zur Löthspitze geführt und so zum Löthen verwendet
werden.
Das Princip des von Enfer und Söhnen in Paris zu diesem Zweck construirten Blasebalges ist von demselben
schon früher zu transportablen Schmiedefeuern angewendet worden,Siehe die Beschreibung ihrer doppelt und continuirlich wirkenden Blasebälge
für Schmieden im polytechn. Journal Bd.
CXLIII S. 174. und sind sich daher diese beiden Gebläsevorrichtungen in der Hauptsache sehr
ähnlich.
Das Gebläse des in Fig. 27 in 1/6 natürlicher Größe dargestellten Apparates besteht in einem
Blasebalg B, der mit seinem oberen Theile an eine, den
ganzen Apparat in zwei Räume theilende, Blechwand luftdicht befestigt ist. Dieser
Blasebalg B, dessen Boden eine gußeiserne Scheibe a bildet, communicirt durch das Ventil D (von 50 Millimeter Durchmesser) mit dem untersten Raum
des cylindrischen Blechmantels, in welchem sich sechs Löcher d befinden, und durch dieselben demnach mit der freien Luft.
Der Raum A über diesem Blasebalg dient als Windreservoir,
und steht durch das Ventil E (von 35 Millimeter
Durchmesser) mit dem unteren Gebläse B in Verbindung. In
diesem Raume A befindet sich nun ebenfalls eine Art
Blasebalg C, der vom anderen dadurch verschieden ist,
daß er durch eine Spiralfeder f fortwährend gespannt
wird. Diese Spiralfeder ist oben an zwei Seiten durch ein umgebogenes Blech
gehalten, welches wiederum durch eine Schraube an einem Holzdeckel c befestigt ist, der den Schluß des Blechcylinders nach
oben bildet. Dieselbe Befestigung hat die Spirale noch unten auf dem Holzdeckel g, durch welchen zugleich der luftdichte Schluß des
Balges C nach unten bewirkt wird. Nach oben hin
communicirt der Raum C durch sechs Löcher h, die im Holzdeckel c
angebracht sind, ebenfalls mit der freien Luft.
Die Bewegung des Balges B geschieht nun mittelst des
Hebels n, der in o seinen
Drehpunkt hat und durch einen Bügel, der an die Scheibe a angeschraubt ist, mit dem Balg B in
Verbindung steht.
Endlich ist noch zu bemerken, daß von dem Windreservoir A
aus der Wind durch das an den Blechmantel angenietete Mundstück m mittelst eines über dasselbe gezogenen Gummirohres
nach dem weiter unten beschriebenen Hahn geleitet wird.
Die Anwendung des transportablen Blasebalges ist eine sehr einfache; derselbe erhält
durch den Blechmantel eine solche Steifigkeit und ist in seinen Dimensionen so
eingerichtet, daß sich eine Person, gewöhnlich ein Knabe, bequem auf den Holzdeckel
c setzen und mit dem Fuß den Hebel n
und hierdurch auch den
Blasebalg B in eine aufgehende Bewegung bringen kann.
Der Niedergang des Balges geschieht durch die Schwere der Scheibe a. Beim Aufgang öffnet sich das Ventil E und läßt die im Raum B
befindliche Luft in das Windreservoir entweichen. Beim Niedergang dagegen füllt sich
der Blasebalg B wieder mit Luft, um dieselbe beim
Aufgang ebenfalls wieder dem Windreservoir zuzuführen.
Kann nun die Luft aus dem Windreservoir nicht sofort entweichen, so muß sie nach und
nach einen Druck auf den Blasebalg C ausüben, denselben
heben und die Spiralfeder f zusammendrücken. Da aber
diese Feder den Balg C wieder auszudehnen strebt, so
wird der Raum, der durch Entweichen der Luft aus dem Mundstück m entsteht, sofort wieder durch den Balg C ausgefüllt, und dadurch ein Ausströmen der Luft mit
nahezu gleichmäßigem Druck erzielt. Es kann hiernach auch ein Ueberblasen des
Apparates nicht leicht stattfinden, ebenso wie ein Verlust an Luft nie eintreten
kann.
Der in Fig. 25
und 26 in 1/8
natürlicher Größe im Durchschnitt und Grundriß dargestellte Apparat zur Erzeugung
des Wasserstoffgases wird durchgängig aus Blei angefertigt. Er besteht aus zwei
Theilen, A und B, wovon A mittelst dreier Säulchen s
(3/4 Zoll starkem Bleidraht) auf der Decke des Raumes B
befestigt ist. Der obere Raum A, von dessen Boden aus
ein Rohr a bis unter die durchlöcherte Scheibe d reicht, ist offen, und wird mit sehr verdünnter
Schwefelsäure, ungefähr in der Mischung von 1 Th. concentrirter Schwefelsäure auf 7
Th. Wasser, angefüllt. Auf der Scheibe b liegen grobe
Stücke Zink, die durch die Oeffnung bei c eingegeben
werden.
Die in A eingefüllte Schwefelsäure tritt nun mittelst des
Rohres a unter die Scheibe b, dringt durch deren Oeffnungen hindurch und füllt theilweise den Raum B aus. – Durch die Einwirkung der verdünnten
Schwefelsäure auf Zink bildet sich, wie bekannt, schwefelsaures Zinkoxyd,
Wasserstoff wird frei, füllt nach und nach ebenfalls den Raum B aus und drängt, sobald er keine Gelegenheit hat, zu entweichen, je nach
seiner Spannung, die im Raume B befindliche
Schwefelsäure wieder zurück nach dem Raume A. Wird dann
durch den Abfluß des Gases dessen Menge geringer, so tritt wieder mehr Schwefelsäure
über das Zink, u.s.w.
Durch das aufgelöthete Rohr d steht der Raum B mittelst eines Gummirohres mit einem kleinen, halb mit
Wasser (oder Kalkmilch) gefüllten Reservoir C in
Verbindung, theils zur Reinigung des Gases, theils um etwa mechanisch mit
übergehende Säure aufzufangen, aus welchem dann durch die Oeffnung e, an welcher ein Kautschukrohr befestigt ist, das Wasserstoffgas nach
dem unten beschriebenen Doppelhahn geleitet wird. Unter der Scheibe b befindet sich noch eine Oeffnung f, die dazu dient, die mit Zinkoxyd mehr oder weniger
gesättigte Schwefelsäure, die sich auf Zinkvitriol weiter verarbeiten läßt, aus dem
Apparat abzulassen. Diese Oeffnung sowohl, als auch die bei c, werden für gewöhnlich einfach durch Korke geschlossen.
Die Wirkung der beiden beschriebenen Apparate vereinigt sich nun in dem in Fig. 28
dargestellten Doppelhahn; Wasserstoff und Luft treten in demselben zusammen und
letztere gibt den zur Knallgasbildung nöthigen Sauerstoff an den Wasserstoff ab.
Durch Oeffnen des dritten Hahnes strömt endlich das Knallgas in dem Gummirohr s nach einer am Ende desselben angebrachten Löthspitze,
mit welcher dann das Löthen auf die bekannte Weise ausgeführt werden kann.
Die Löthung von Blei geschieht beispielsweise auf folgende Art: Das eigentliche Loth
besteht hier aus dünnen Bleistreifen, denen mittelst eines Schabers eine metallisch
reine Oberfläche gegeben wird. Will man nun Bleitafeln mit Bleitafeln, Bleirohre mit
solchen, oder Bleirohre unter einander verlöthen, so wird den sich berührenden
Kanten ebenfalls durch den Schaber, der eine dreiseitige Fläche hat, um mit den
Spitzen auch in die kleinsten Ecken gelangen zu können, eine metallisch reine
Oberfläche gegeben, diese Kanten möglichst scharf zusammengestoßen, und, ehe das
Loth darauf kommt, dieselben der Löthflamme kurze Zeit ausgesetzt, um sie vorläufig
zu erwärmen und sie zur Aufnahme des Lothes vorzubereiten. Dann bringt man das Loth
ebenfalls unter die Löthflamme und läßt den sich bildenden Bleitropfen auf den
Zusammenstoß der beiden Kanten fallen, wodurch eine Verbindung derselben hergestellt
wird. Ehe man aber den nächsten Tropfen vom Loth abschmilzt, läßt man die
Knallgasflamme noch kurze Zeit auf den ersten einwirken, damit derselbe ordentlich
ausfließt und eine breite Löthnaht erzeugt. Am einfachsten ist natürlich das Löthen
bei horizontaler Lage der Kanten, weil hier die Tropfen vom Loth ebenfalls
horizontal nebeneinander zu liegen kommen; schwieriger ist es schon, eine Löthnaht
in verticaler Richtung, wo die Bleitropfen übereinander kommen, herzustellen, doch
läßt sich die hierzu nöthige Fertigkeit in wenigen Tagen der Uebung leicht aneignen.
Ein geübter Löther kann in einer Stunde eine Löthnaht von 5,5 Meter Länge herstellen
und bedarf hierzu außer einer Person, die den Blasebalg in Bewegung setzt, bei
größeren Arbeiten gewöhnlich noch eines Gehülfen, der die Kanten der zu löthenden
Gegenstände scharf zusammenpreßt.
Das Löthen mit Knallgas mittelst der beschriebenen transportablen Apparate hat in
Frankreich bereits eine weite Verbreitung, nicht nur in den größeren chemischen und
überhaupt industriellen Etablissements, sondern auch bei den kleineren
Gewerbtreibenden, wie Kupferschmieden, Bijouteriefabrikanten, Goldschmieden,Siehe über die Benutzung dieser Apparate zum Löthen mit Aluminiumloth in
Stangenform die Abhandlung im polytechn. Journal Bd. CLVII S. 445. Knopfmachern u.a. gefunden und ist wegen seiner Billigkeit und allseitigen
Anwendbarkeit zu empfehlen.
Tafeln