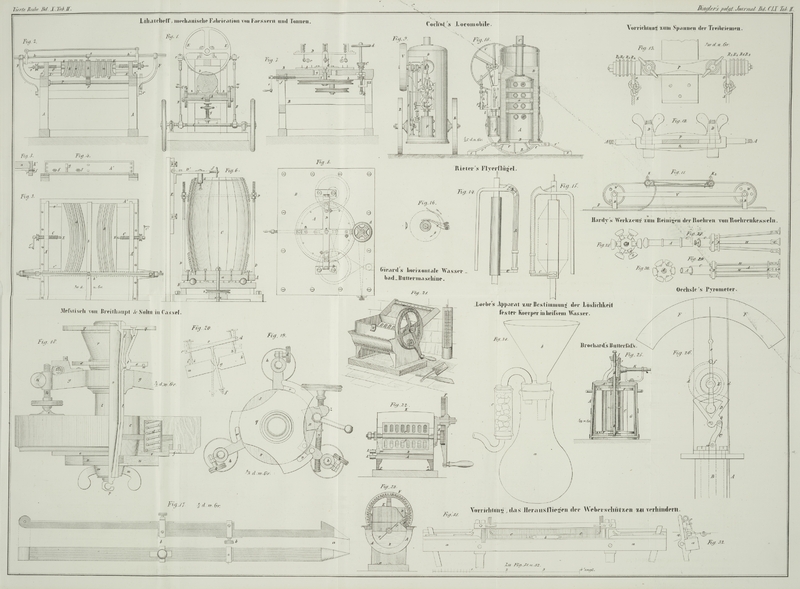| Titel: | Vorrichtung zum Spannen der Treibriemen; beschrieben von G. H. Bruns in Zürich. |
| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. XXVI., S. 86 |
| Download: | XML |
XXVI.
Vorrichtung zum Spannen der Treibriemen;
beschrieben von G. H. Bruns
in Zürich.
Aus der schweizerischen polytechnischen Zeitschrift, 1860,
Bd. V S. 116.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Brunn's, über eine Vorrichtung zum Spannen der
Treibriemen.
Bekanntlich müssen die Lederstreifen, welche zum Maschinenbetrieb benutzt werden
sollen, vor dem Gebrauch ausgezogen werden. Es wird dieses zwar dadurch
bewerkstelligt, daß man die Riemenstücke mit vielem Gewichte belastet aufhängt. Zu
gleichem Zwecke dürfte sich jedoch der, in der Maschinenmodellsammlung des eidgen.
Polytechnicums befindliche, sogenannte
„Riemenspannflaschenzug“, wovon Fig. 11–13 eine
Skizze, als bedeutend bequemer herausstellen.
Fig. 11
stellt den Apparat zum Ausziehen der Riemenstücke in der
Seitenansicht in 1/10 natürlicher Größe dar. Auf einer hölzernen Fußplatte F sind zwei schmiedeeiserne Bügel B befestigt, welche zur Lagerung zweier aus feinem Holz verfertigten Walzen W dienen,
die mit eisernen Seitenplatten versehen; jede Walze ist mit einer messingenen Büchse
durchdrungen, und dreht sich auf dem durchgesteckten schmiedeeisernen Bolzen Z Um die Walzen in unveränderlicher Entfernung gegen
einander zu halten, sind gleichzeitig auf dem Bolzen zwischen Walze und Bügel zwei
an den Enden durchbohrte Verbindungsstangen V
eingeschaltet. Die Enden des um die Walzen gelegten Riemens sind in die Klammern K¹ und K²
eingeschraubt. Um letztere näher kennen zu lernen, ist K² in Fig. 12 und 13 in 1/3 natürlicher
Größe abgebildet. Derselbe besteht aus zwei aus Stahl verfertigten Platten P und Q, die in der Mitte so
verstärkt sind, daß auch die den dazwischen gelegten Riemen zugekehrten Flächen
etwas convex sind, um beim Anziehen der Schrauben D das
Leder gegen scharfes Einkneifen zu sichern. Gleichzeitig sind diese Flächen wie eine
Feile gehauen, und die Platte etwas gehärtet. Die untere Platte Q hat an beiden Enden als cylindrische Fortsetzungen
Achsen A die dazu bestimmt sind, eine Scheibe mit Oese O, zur Befestigung eines gewöhnlichen dünnen Seiles 8
dienend, außerdem aber noch vier kleine eiserne Rollen R², R⁴, R⁶ und R⁸ zu tragen; alle fünf
Theile werden durch eine Schraubenmutter mit Scheibe M
auf der Achse gegen Seitenverschiebung gehalten. Ganz gleich ist der Klemmer K¹ mit den Rollen R¹, R³, R⁵ und R⁷ gebildet, nur hat
dieser an Stelle der Oesenscheibe O bei K² eine einfache und an Stelle der einfachen
Scheibe M bei K² eine
Scheibe mit größerer Oese. Legt man jetzt das mit dem einen Ende in O befestigte Seil um die Rolle R¹; des K¹, von hier um R² des K²,
dann um R³, R⁴
u.s.f. und um R⁸, so sind zwei kleine
Flaschenzüge, jeder mit acht Seilen zum Gebrauch hergerichtet, mit denen man ohne
großen Kraftaufwand ein enormes Ausziehen des Riemens bewirken kann. Hat man nun das
Stück hinlänglich ausgedehnt, und die Klemmer den Walzen wo möglich parallel
gestellt, so knüpft man das übrig gebliebene Seil in die Oese des K¹ fest, und überläßt das so ausgezogene
Riemenstück dem Austrocknen.
Hat man später durch Zusammennähen oder durch sonstigen Verband der Enden dieser
ausgezogenen und ausgetrockneten Riemenstücke den gewünschten Treibriemen
hergestellt, so legt man diesen um die für ihn bestimmten Riemenscheiben, schraubt
wieder die Klemmer auf, jedoch so, daß die beiden Riemenenden frei bleiben, richtet
den Flaschenzug her und nähert durch leichtes Anziehen der Seile die Enden einander,
knüpft die Seile wieder in die Oesen fest, und probirt jetzt ob der Laufriemen zur
Genüge gespannt ist. Wenn letzteres der Fall ist, so kann die Schlußverbindung mit
größter Genauigkeit und Bequemlichkeit bewerkstelligt werden, wodurch dem
langwierigen Aufspannen so einfach vorgebeugt wird. Schon allein die letztere
Verwendung des Riemenspannflaschenzuges, zumal beim Aufspannen breiter und doppelter
Riemen, läßt hoffen, daß derselbe bald eine große Anwendung in den Fabriken finden
wird.
Noch sey bemerkt, daß Hr. Reishauer, Mechaniker in Zürich,
obigen Apparat zu billigem Preise anfertigt, sowie auch stets Lager davon hält.
Tafeln