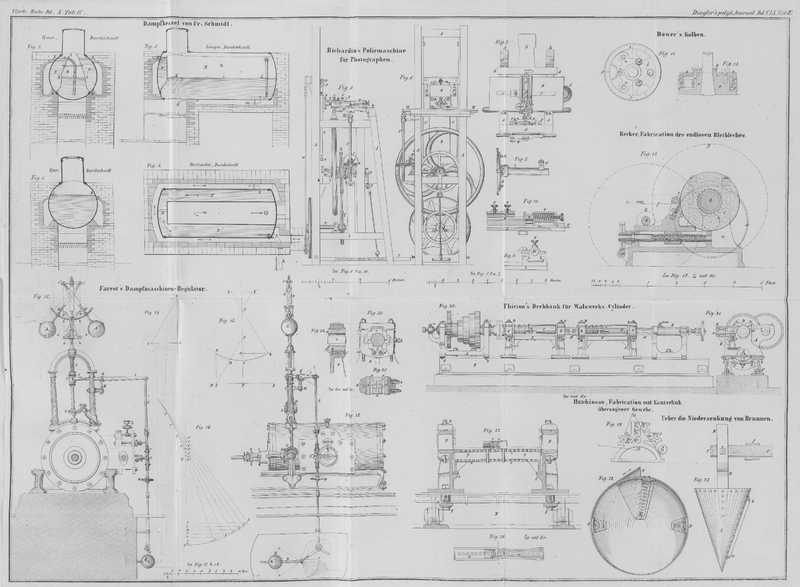| Titel: | Dampfkessel von Fr. Schmidt, Ingenieur in Haspe. |
| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. LXXI., S. 241 |
| Download: | XML |
LXXI.
Dampfkessel von Fr. Schmidt, Ingenieur in Haspe.
Für Preußen auf 5 Jahre patentirt am 12. December 1860.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Schmidt's Dampfkessel.
Dieser Kessel bezweckt durch seine eigenthümliche Einrichtung gegen die bisher
üblichen Constructionen:
1)eine größere Dampfentwickelung bei gleichem
Kessel-Volumen;
2)eine größere Sicherheit gegen das Eintreten von
Wassermangel und die dadurch bedingten Unglücksfälle;
3)eine sowohl im Interesse einer möglichst raschen
Verdampfung, als der ökonomischen Benutzung des Brennmaterials wirkende
Wasser-Circulation;
4)Verhütung des Kesselsteins an den gefährlichen
Stellen.
Fig. 1 stelle
das Querprofil eines gewöhnlichen einfachen Walzenkessels dar. Die Linie A, B bezeichne den niedrigsten Wasserstand, welcher den
gesetzlichen Bestimmungen gemäß immer noch mindestens 4 Zoll oberhalb der höchsten
Stelle C der Feuerzüge reicht. Durch das passende
Raumverhältniß zwischen Wasser- und Dampfraum ist die Grenze A, B und somit die höchste Stelle der Feuerzüge
bestimmt.
Fig. 2 zeigt
den Querdurchschnitt, Fig. 3 den Längen-,
und Fig. 4 den
Horizontal-Durchschnitt des patentirten Kessels mit der passenden
Einmauerung.
In einen gewöhnlichen cylindrischen Kessel denke man die beiden dünnen Bleche A, B und C, D bei B und D festgenietet und
wasserdicht gestemmt. Hierdurch entstehen in dem Kessel die beiden, oben offenen
Seitenkammern N, N, welche an der vordern Kopfwand durch
die Querkammer O verbunden sind. Die in den Kessel
genieteten Bleche haben, abgesehen von Niveau-Differenz auf beiden Seiten,
den gleichen Druck auszuhalten und werden daher in der geringen Dicke angewendet,
welche zur Erzielung einer wasserdichten Verbindung als Mininum erforderlich
ist.
ad 1. Es ist klar, daß durch diese beschriebene
Einrichtung der Wasserstand in den äußeren Kammern N, N
und O bis zur Niveau-Linie E, F erhöht wird, während zwischen den Blechen die Mittelkammer M als Dampfraum dient, welchen letzteren unten der
Wasserspiegel K, L begrenzt. Durch die Erhöhung des
Wasserstandes an den feuerberührten Flächen ist somit eine mit diesen proportionale
größere Dampfentwickelung erzielt.
ad 2. Da nach der unten ad 3
näher erläuterten Art der Wasser-Circulation in den Seitenkammern
hauptsächlich ein Vorwärmen des Speisewassers stattfindet, die
Haupt-Verdampfung dagegen in dem Mittelraum M,
als direct über dem Roste liegend, erfolgt, so wird in letzterm M ein relativ schnelleres Fallen des Wasserspiegels
eintreten, als in den Seitenkammern. Ein mit der Mittelkammer verbundener
Wasserstandszeiger, Schwimmer etc. wird somit ungleich empfindlicher seyn, als bei
gewöhnlichen Kesseln. Rechnet man hierzu noch, daß ein bedeutendes Fallen des
Wasserstandes in der Mittelkammer eintreten darf, ohne die Züge bloß zu legen, so
leuchtet die erzielte größere Sicherheit ein.
ad 3. Das Wasser bewegt sich im Kessel der Richtung des
Feuers entgegen. In Fig. 3 und 4 tritt das Wasser durch
das Rohr R bei S in die eine
Seitenkammer, bewegt sich durch diese, der Richtung des Pfeils entsprechend, nach
vorn, hier durch die Querkammer O in die andere
Seitenkammer, durch diese nach dem hinteren Kesselende, wo es bei T durch das Rohr U in das
hintere Ende der Mittelkammer gelangt, durch welche es sich zur Ausgleichung des
Wasserspiegels nach vorn bewegt. Das Feuer macht den umgekehrten Weg, so daß es auf
seiner Bewegung nach dem Schornsteine mit immer kälteren Kesselwandungen in
Berührung kommt. Hierdurch wird das Brennmaterial am vortheilhaftesten benutzt,
indem die Verbrennungsproducte mit möglichst geringer Temperatur in den Schornstein
gelangen.
ad 4. Da das Speisewasser, ehe es die mittlere Kammer
erreicht, beide Seitenkammern passiren muß, so wird es in diesen bis zum Sieden
vorgewärmt. Schlamm und Kesselstein werden sich daher zum größten Theile, wenn nicht
ganz, in den Seitenkammern ausscheiden und an die Böden derselben absetzen. Diese
sind mit Feuer nicht berührt, die Ablagerung also ohne Gefahr. Der hierdurch
erzielte Vorzug tritt besonders stark hervor, wenn man bedenkt, daß bei gewöhnlichen
Kesseln die Ablagerung sich auf den unmittelbar über dem Roste liegenden Boden
ansetzt.
Hiermit sind die wesentlichen Vortheile des neuen Kessels nachgewiesen.
Schließlich bemerke ich, daß Hrn. L. Stuckenholz in Wetter
a. d. Ruhr die alleinige Anfertigung der patentirten Kessel übertragen worden
ist.
Haspe, 1. März 1861.
Tafeln