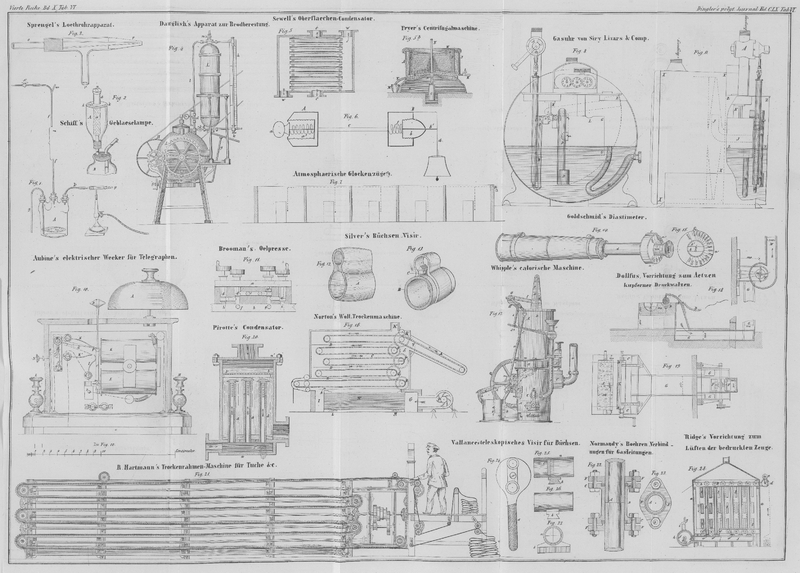| Titel: | Elektrischer Wecker für Telegraphen, von Aubine und Mouilleron in Paris. |
| Fundstelle: | Band 160, Jahrgang 1861, Nr. CXXI., S. 434 |
| Download: | XML |
CXXI.
Elektrischer Wecker für Telegraphen, von
Aubine und Mouilleron in Paris.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, Januar 1861, S. 15.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
Aubine's elektrischer Wecker für Telegraphen.
Die Läute- oder Weckerwerke der Telegraphen sind zweierlei Art: sie werden
entweder durch ein Uhrwerk bewegt und die Elektricität dient dann nur zum Auslösen
dieses Mechanismus; oder es wird die Elektricität mittelst eines Stromunterbrechers
direct zur Bewegung des Läutewerkes nach Art der bekannten Hammerapparate benutzt.
Da die elektrische Kraft in der Regel nur eine sehr geringe ist, so sind die meisten
Werke von der ersten Art. Wenn man der größeren Einfachheit in Construction und
Bedienung wegen die zweite Art anwandte, suchte man sich entweder durch große
Empfindlichkeit der Construction oder durch Anbringung eines Relais zu helfen. Nach
dem System von Aubine wird die Einrichtung so getroffen,
daß das Weckerwerk sein eigenes Relais bildet. Der Apparat zeichnet sich durch seine
große Einfachheit aus. Er besteht aus einem gewöhnlichen Läutewerk, dessen
bewegliche Armatur einen Zahn trägt, auf welchen ein beweglicher Hebel drückt, der
durch eine Feder fortwährend nach unten gezogen wird. Dieser bewegliche Hebel
befindet sich zwischen zwei Federn, deren eine mit dem Leitungsdraht, die andere mit die Localbatterie in
Verbindung steht. Endlich ist der Hebel selbst mit derjenigen Feder des
Stromunterbrechers verbunden, welche die Armatur des Elektromagnets berührt, dessen
Draht außerdem nach der Erdleitung geht.
Wenn der bewegliche Hebel durch den Zahn der Armatur des Magnets gehalten wird, so
berührt er die obere Feder und schaltet dadurch das Läutewerk in die Leitung ein.
Unter dem Einfluß des Stromes von der correspondirenden Station wird die Armatur
angezogen, der Hebel vom Zahn abgelöst und auf die untere Feder niedergelassen.
Dadurch kommt das Läutewerk aus der Hauptleitung heraus und in die Leitung der
Localbatterie, deren Strom nun Kraft genug hat, um sie gehörig in Thätigkeit zu
setzen.
Das Neue an diesem elektrischen Wecker ist also nur der Apparat zum Unterbrechen des
einen und zum Schließen des andern Stromes. Um den Apparat nach jedem Läuten wieder
in richtigen Stand zu setzen, braucht man nur den Hebel des Stromunterbrechers
wieder in seine erste Lage zu bringen, was mittelst eines eisernen Griffs
geschieht.
Die Apparate nach dem neuen System werden von Mouilleron
und Gaussin in Paris (place
Dauphine) sehr gut ausgeführt.
Erklärung der Abbildung, Fig.
10.
A Glocke, auf dem den Apparat enthaltenden Gehäuse
angebracht.
B Hammer mit biegsamem Stiel; er geht durch eine
passende Oeffnung in der Wand des Gehäuses.
C Armatur, an welche der Stiel des Hammers befestigt
ist, und die an ihrem unteren Ende eine elastische Zunge trägt, welche den Zweck hat
abwechselnd zwei Contactschrauben, zwischen denen sie hin und hergeht, zu
berühren.
D Lager für die Drehachse.
E Spiralen des als Relais dienenden Elektromagnets.
F Zahn oder Ansatz am obern Ende der Armatur, welcher
den beweglichen Hebel G trägt, wenn das Läutewerk außer
Thätigkeit ist, wie es die Figur darstellt.
G doppelarmiger Hebel, um H
drehbar und in Verbindung mit der Feder I.
I Feder, welche beständig auf die Armatur C drückt.
J Feder, welche auf den kürzeren Hebelarm von G drückt und also den Zahn F
auszulösen strebt, welcher den längern Hebelarm unterstützt.
K obere Feder, in Verbindung mit dem Draht der
Luftleitung; sie ist in Berührung mit dem Hebelarm G,
wenn er auf dem Zahn liegt.
K' untere Feder, in Verbindung mit der
Localbatterie.
L Knopf, wo die Luftleitung einmündet.
M Knopf, welcher die Verbindung zwischen dem
Elektromagnet E und der Erde herstellt. Der Knopf für
den Draht zur Verbindung der Localbatterie und der Feder K befindet sich hinter L, an der andern Ecke
der Fußplatte.
Die angedeuteten Verbindungen sind in der Figur durch punktirte Linien
dargestellt.
Hat Alles die gezeichnete Lage, d.h. liegt der Hebel auf dem Zahn F und kommt der Strom durch die Hauptleitung, so wird
die Armatur C angezogen, und sogleich fällt der Hebel,
da der Zahn sich unter ihm entfernt, auf die untere Feder K'; dadurch ist nun das Läutewerk in den Strom der Localbatterie
eingeschaltet und die Armatur C, kräftig angezogen,
bringt den Hammer so lange in Thätigkeit, bis man den Hebel wieder in sein Ruhelager
auf dem Zahn zurückbringt.
Hiezu dient der äußere Knopf N mit einer innerhalb des
Gehäuses befindlichen Feder O. Drückt man nur einmal auf
diesen Knopf, so wird dadurch der kürzere Hebelarm bewegt, mithin der längere Arm
gehoben und auf den Zahn F aufgelegt, worauf das
Anschlagen des Hammers sofort aufhört.
Tafeln