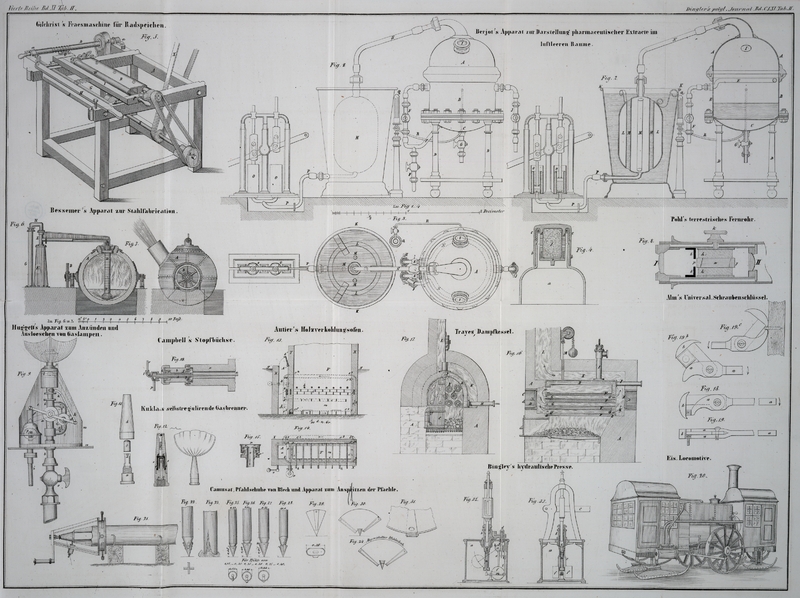| Titel: | Camusat's Pfahlschuhe von Blech und Apparat zum Anspitzen der Pfähle. |
| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XXVI., S. 89 |
| Download: | XML |
XXVI.
Camusat's Pfahlschuhe
von Blech und Apparat zum Anspitzen der Pfähle.
Aus Förster's
allgemeiner Bauzeitung, 1861 Heft 2 und 3, S. 52.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Camusat's Pfahlschuhe von Blech.
Der Bauunternehmer Camusat in Paris hat einen blechernen
Pfahlschuh construirt, der die guß- oder schmiedeeisernen Schuhe ersetzen
soll, deren man sich bisher zur Armirung von Rammpfählen bediente. Auch erfand er
eine sehr einfache Maschine zu dem Zweck, die Spitzen der Pfähle auf eine
regelmäßige Weise anzuschneiden, so daß zwischen der hölzernen Spitze und der
blechernen Hülle, welche die erstere beschützen soll, kein Spielraum
stattfindet.
In Fig. 21 der
betreffenden Abbildungen ist ein Umriß dieser Maschine gegeben, und in Fig. 25 bis
28 sind
Schuhe verschiedenen Kalibers dargestellt, wie sie nach dem jeweiligen Durchmesser
der Pfähle zu verwenden sind.
Der Apparat (Fig.
21) besteht aus einem unbeweglichen runden Kranze mit Rand, an dem
mittelst Krammen ein beweglicher eiserner Kreis mit zwei geneigten Schenkeln
befestigt ist, die an einer Kurbel sitzen, woran sich eine Achse befindet, deren
Spitze in den Pfahl eindringt. Der eine der geneigten Schenkel ist massiv, während
der andere aus zwei kleinen Winkeleisen gebildet ist, die so weit auseinander
stehen, daß zwischen ihnen eine Schraube ohne Ende passiren kann, an welcher sich
ein kleiner Schlitten befindet, woran ein Messer in Form eines Drehstahls angebracht
ist. Man bringt das Messer der Pfahlseite mittelst einer Schraube unter dem
Schlitten näher oder entfernter, je nachdem es nothwendig wird.
Die Behandlung und Anwendung dieser Vorrichtung ist ganz einfach. Ob der Pfahl rund,
vieleckig oder rechteckig sey, so wird er der Länge nach durch Linien in zwei sich
rechtwinkelig schneidenden Ebenen, die durch die Achse des Pfahls gehen, getheilt,
und es wird diese Achse durch ein Loch an dem Ende des Pfahls angegeben. Ist der
letztere mit dem Beile oberflächlich gespitzt, so setzt man die eiserne Achse, die
sich an der Kurbel befindet, in das an dem Ende des Pfahls gemachte Loch und schiebt
den festen Kranz an den Pfahl, der mit vier Schrauben daran befestigt wird, die im
rechten Winkel durch ihn gehen und die man genau mit den an dem Pfahl vorgerissenen
Linien in Uebereinstimmung bringt. Hat man den Messerschlitten vorher bis zum untern Theil des ihn
tragenden Schenkels herabgeschoben, so wird die Kurbel gedreht und der bewegliche
Kranz nebst seinen beiden geneigten Schenkeln und dem Messer, dessen Länge man
früher regulirt hat, folgt dieser umdrehenden kreisförmigen Bewegung.
Damit der Schlitten längs der Schraube, in die er eingreift, vorgehe und folglich die
Pfahlspitze conisch abschneide, hat der Erfinder das Ende der Schraube mit einem
Sternrade versehen und an der äußeren Fläche des unbeweglichen Kranzes vier kleine
Aufhalter in Form von Nagelköpfen angesetzt. Wenn nun bei der Umdrehungsbewegung,
welche dem Apparate durch die Kurbel mitgetheilt wird, das mit der Schraube ohne
Ende fest verbundene Sternrad an einen dieser Aufhalter anlangt, so erhält diese
Schraube einen Theil der Umdrehung, durch welche der Schlitten hinaufgeht. Auf diese
Weise gelangt das Messer an das Ende seines Laufs und nimmt das ihm entgegenstehende
Holz mit der größten Leichtigkeit hinweg. Zwei Arbeiter können mittelst dieser
Maschine täglich 20 bis 25 Pfähle spitzen.
Beim Einrammen der Pfähle in leicht zu durchdringendem Erdreich begnügt man sich
damit, ihre Spitzen am Feuer zu Härten; in festem Terrain aber oder in abwechselndem
hat man bisher diese Spitze mit einem gußeisernen oder mit einem solchen
schmiedeeisernen Schuh armirt, wie er in Fig. 22 dargestellt ist.
Die gußeisernen Schuhe aber zerbrechen und die schmiedeeisernen mit ihren Lappen
umschließen die Pfahlspitze nicht vollständig; auch lösen sich die letzteren beim
Einrammen leicht ab, was zur Folge hat, daß der Pfahl, wenn er ein Hinderniß findet,
seinen Schuh verliert, sich spaltet und umlegt, wie aus Fig. 23 zu ersehen
ist.
Die Schuhe des Hrn. Camusat haben gegen die vorigen den
Vortheil ganz glatter Flächen, welche die Pfahlspitzen aufs wirksamste beschützen,
indem sie sich scharf an dieselben anlegen. Die Pfahlspitzen können sich also nicht
umlegen und das Einrammen der Pfähle geht leichter, regelmäßiger und sicherer vor
sich. Die Spitze des Schuhes hat übrigens so viel Widerstandsfähigkeit und ist so
scharf, daß sie die ihr in den Weg tretenden harten Körper leicht durchstoßen
kann.
Diese Schuhe bestehen aus einem Blech, das nach einem Formbret zugeschnitten wird,
welches mit der Stärke des zu bewaffnenden Spitz- oder Spundpfahls im
Verhältniß steht (Fig. 24 und 30); dann dreht man
dieses Blech über einen eisernen Dorn in der Form der Pfahlspitze, und der
überstehende Theil an jeder Seite des Blechs dient zur Bildung einer Ueberfalzung,
die man nach der Wegnahme des Dorns mit kalt eingeschlagenen Nägeln befestigt (Fig. 31).
Der also gebildete Mantel hat an dem Ende des Kegels eine runde Oeffnung, worin man
mit Gewalt eine schmiedeeiserne Spitze, das Ende des Schuhes, eintreibt und
festschmiedet. Die Ueberfalzung des Blechs und die Anschweißung haben eine große
Festigkeit.
Fig. 25, 26 und 27 stellen
Pfähle von verschiedenen Stärken dar und darunter sind die Grundrisse der Schuhe mit
ihrer mittleren Oeffnung im Lichten angegeben. Die Stärke des Blechs für diese drei
Kategorien von Schuhen ist 0,25, 0,30 und 0,40 Millimeter, und ihr gewöhnliches
Gewicht beträgt 3, 5 bis 7 Kilogramme. Bei festem Grunde vermehrt man die eben
angegebenen Stärken des Blechs um ein Geringes. Wenn man für den stärksten der drei
Pfähle die Stärke des Blechs mit 0,50 Millimeter rechnet, so beträgt das Gewicht des
Schuhes 10 bis 11 Kilogr.
In Fig. 28
sehen wir einen Spundpfahl von 0,40 Met. Breite mit seinem Schuh, und in den beiden
Fig. 29
den Grund- und den Aufriß der Armatur eines Spundpfahls von 0,21 bis 0,22
Met. Breite. Dieser Schuh wiegt 2,5 Kilogr. bei einer Viechstärke von 0,25 Millim.
Bei Spundpfählen von 0,40 Met. Breite kann man die Viechstärke zu 0,50 Millim. und
das Gewicht des Schuhes mit 11 Kilogr. annehmen.
Es dürfte unnütz setzensetzn, eine Vergleichung zwischen den Schuhen von Blech und denen von Gußeisen
aufzustellen, da man die letzteren beinahe ganz aufgegeben hat; was die
schmiedeeisernen Schuhe mit Federn oder Lappen betrifft, so beträgt ihr Gewicht
beiläufig das Doppelte von dem der blechernen Schuhe.
Tafeln