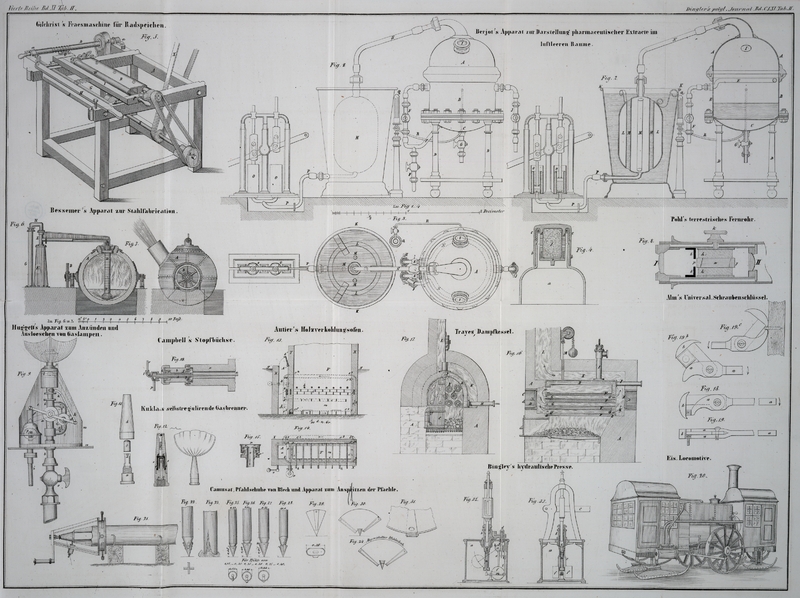| Titel: | Holzverkohlungsofen von Autier in Breins bei Belley. |
| Fundstelle: | Band 161, Jahrgang 1861, Nr. XXXIII., S. 102 |
| Download: | XML |
XXXIII.
Holzverkohlungsofen von Autier in Breins bei Belley.
Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1861, S. 263.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Autier's Holzverkohlungsofen.
Dieser Ofen bezweckt die Vermeidung der bekannten Uebelstände der gewöhnlichen
Meilerverkohlung, und bei einfacher Construction einen in allen Fällen regelmäßigen
und sicheren Gang der Operation. Es sollen dadurch folgende Vortheile erreicht
werden:
1) vollkommene Verkohlung aller Theile des Holzes, ohne zu große Erhöhung der
Temperatur (welche höchstens auf 700° C. steigen darf);
2) zur Wärmeentwickelung die werthlosen Abfälle anwenden zu können, welche sich in
den Wäldern vorfinden, wodurch also die Aeste und Zweige nutzbringender verwendet
werden können;
3) vollständige Ausnutzung der Wärme, welche die fertigen Holzkohlen abgeben, wenn
sie vor der Aufbewahrung abgekühlt werden.
Fig. 13 ist
ein Längendurchschnitt dieses Ofens, Fig. 14 ein
Horizontaldurchschnitt desselben nach einer über dem System der
Wärmevertheilungscanäle befindlichen Ebene, und Fig. 15 ein Durchschnitt
des Zugregulirapparates in größerem Maaßstabe.
Der Ofen besteht in einem rechteckigen Behälter X aus
Ziegeln oder Eisenblech, der auch im Walde selbst leicht hergerichtet werden kann.
Die Höhe desselben beträgt 3–4 Meter und mehr, je nach Bedürfniß. Er ist
durch die Scheidewand Y in zwei Theile getheilt, deren
einer A die Feuerung, und der andere F den eigentlichen Verkohlungsraum bildet. Die innere
Breite des Ofens entspricht der Länge der gewöhnlichen Holzscheite; die Länge des
Raumes richtet sich nach der Höhe und nach der in Arbeit zu nehmenden Holzmenge.
In einer gewissen Höhe ist eine Reihe runder Eisenstäbe h
angebracht, welche von außen entweder einzeln oder mittelst Zahnräder gleichzeitig
in Drehung versetzt werden können. Der Zwischenraum zwischen diesen Stäben beträgt
etwa 3 Decimeter. Unmittelbar unter dieser Art von Rost befindet sich eine
horizontale Mauer mit zahlreichen rechteckigen Oeffnungen i, welche mit einem großen Canal j in
Verbindung steht, der seinerseits durch die Oeffnungen k
direct mit dem Feuerraum A verbunden ist.
Wenn der Ofen im Walde auf unebenem Boden aufgestellt werden soll, so kann er mit
seinen Rück- und Seitenwänden, etwa bis g in der
Erde stehen, was der Festigkeit und der Hitze des Ofens zu gute kommt.
Eine Hauptsache bei der Verkohlung mittelst dieses Apparates ist es, zu verhindern,
daß der Brennstoff nicht selbst an das zu verkohlende Holz Feuchtigkeit abgibt. Zu
diesem Zwecke befindet sich in dem Raum A die durch den
Hebel v zu bewegende Zwischenplatte B, welche von außen regiert werden kann oder durch ein
Gegengewicht balancirt ist. Zuerst kommt der Brennstoff in den Raum A', wo er zwischen der Platte B und dem Deckel b' eingeschlossen ist. Durch
leichte Lüftung von B und b'
treten so viel Feuergase in diesen Raum, daß der Brennstoff vollkommen trocken wird,
worauf man ihn durch Bewegung von B nach dem
eigentlichen Herde hinabfallen läßt.
Die heißen im Herde erzeugten Gase treten durch j und k in den Verkohlungsraum, um daselbst durch die
Oeffnungen i hindurch auf das Holz einzuwirken.
Die Holzstücke werden in F in horizontalenhorizonalten Schichten angeordnet; man legt zu unterst eine oder zwei Schichten vom
dicksten Holze quer auf die Stäbe h, hierauf eine
dieselbe kreuzende von 3 Decimeter Dicke und so weiter bis zum oberen Rande des
Ofens.
Wenn das Holz in Folge der Verkohlung nachsinkt, so fährt man oben mit dem Auflegen
neuer Schichten in derselben Weise fort.
Die untere Holzschicht verkohlt sehr bald, die zerbrochenen Kohlen fallen in den
unteren Theil des Ofens, woraus sie nach dem Abkühlen durch die Thüren n herausgezogen werden. Wenn die Kohlen nicht schnell
genug zerbrechen, so befördert man dieß durch gleichmäßiges und gleichzeitiges
Umdrehen der Roststäbe.
Wenn man die Kohlen ziehen will, so verschließt man die obere Oeffnung des Ofens
vollständig, und versperrt nach dem Herausziehen die Thüren n sofort wieder. Es darf keine andere Luft in den Ofen gelangen, als
diejenige, welche durch die Röhre t eintritt. Der Gang
der Luft und der Gase ist in der Figur durch Pfeile angedeutet.
Um die Abkühlung bei m zu beschleunigen, steht dieser
Raum mit einem Canal c durch ähnliche Oeffnungen wie die
oberen i, in Verbindung. Dieser Canal t, welcher nach t¹,
t², t³
gekrümmt ist, verbindet sich mit dem Canal c, welcher
die Leitung t umgibt. Der Canal c ist weit genug, um den darin enthaltenen Gasen zu gestatten die Leitung
t zu erhitzen. Die heißen und unverbrennlichen Gase
der Kohle steigen in dem Canal c; in die Höhe, indem sie
durch die Theile c¹, c² etc. hindurchgehen und fallen durch die oben angedeuteten Oeffnungen wieder
in den Kohlenbehälter m zurück, nachdem sie durch
Berührung mit der Röhre t kälter und schwerer geworden
sind. Diese Gase verbrennen die Kohle nicht und übertragen also die Hitze derselben,
während des Verlöschens, an den Herd A, mit welchem die
Röhre t in Verbindung steht. Es wird diesem also die
Hitze zugeführt, welche die Kohle während des Abkühlens abgeben muß.
Der Herd muß wie bei anderen Oefen durch äußere Luft gespeist werden, dieß geschieht
hier in selbstregulirender Weise durch die Hitze des Ofens selbst.
Am Ende der Röhre t ist damit eine Röhre o verbunden (Fig. 15), deren oberes
Ende ringförmig erweitert und umgebogen ist; an diesem Ende ist ein ringförmiges bis
an den Rand mit Wasser gefülltes Gefäß s befestigt. Ein
in verticaler Richtung frei beweglicher Deckel p trägt
ebenfalls einen Wasserbehälter s', in welchen ein
zurückgebogener Kranz r des Rohres o eintauchen und so einen hydraulischen Verschluß bilden
kann. Unter dem Behälter s' befindet sich ein zweiter
Kranz r', welcher ebenfalls in das Gefäß s eintauchen und damit einen dichten Verschluß des
Deckels p bilden kann.
In dem Canale j für die heißen Gase ist etwa bei j² die Luftsaugeröhre o angebracht, deren Deckel p an einem Hebel
hängt; dieser Deckel spannt durch sein Gewicht den 2–3 Millim. starken
Messingdraht, an welchem er hängt, hinreichend. In Fig. 15 deuten die Pfeile
die für den Eintritt der Luft gelassenen Oeffnungen an. Je nachdem die Hitze in den
Canälen größer oder geringer ist, wird der Draht mehr oder weniger ausgedehnt und
der Deckel p steigt oder sinkt dem entsprechend, wodurch
also der Kranz r sich dem Wasser des Behälters s' mehr oder weniger nähert und so die Menge der
eintretenden Luft vermindert oder vermehrt. Taucht der Kranz r in das Wasser ein, so wird der Luftzutritt ganz abgesperrt. Auf diese
Weise kann die Temperatur des Ofens eine bestimmte Grenze nicht übersteigen, welche
man auf etwa 650° C. normirt, indem man den Ausdehnungscoefficienten des
regulirenden Messingdrahtes mit 0,000019 in Rechnung zieht.
Sollte diese Vorschrift vernachlässigt worden seyn, so tritt der Hülfsbehälter s in Thätigkeit. Wenn nämlich die Temperatur das
festgestellte Maximum übersteigt, so dehnt sich der Draht zu stark aus, der Deckel
sinkt herab und der Kranz r¹ taucht in das untere
Bassin s und versperrt also den Zug.
Man erkennt, daß bei diesem Verfahren die Hitze benützt wird, welche der freie
Wasserstoff des zu verkohlenden Holzes entwickelt, was beim Verkohlen in
geschlossenen Gefäßen nicht leicht zu bewirken ist.
Das Holz enthält im Kubikmeter 3 bis 3,6 Kil. oder im Mittel 3,3 Kil. freien
Wasserstoff, woraus durch Verbindung mit Sauerstoff – da jedes Kilogramm
hiebei 23500 Wärme-Einheiten entwickelt –
23500 . 3,30 = 77550 W. E.
entwickelt werden.
Bei dem neuen Verfahren verbindet sich der Wasserstoff vollständig mit dem wenigen
Sauerstoff, welchen die Verbrennung im Herde hinterließ. Der Wasserstoff verhindert
also durch seine größere Verwandtschaft zum Sauerstoff jede Verbrennung von
Kohlenstoff im Innern des Ofens; dieß ist ein großer Vortheil, welcher bisher nicht
gehörig beachtet worden zu seyn scheint.
Mit diesem neuen Apparat hat man es erreicht, nur 75 Kil. oder 1/5–1/4
Kubikmeter Holz zu verbrennen, um 1 Kubikmeter Holz zu verkohlen, was also eine
Ersparniß von 60 Proc. gegen andere Methoden ergibt, die für jeden zu verkohlenden
Kubikmeter etwa 2 Kubikmeter Holz erforderten.
Endlich ist noch hervorzuheben, daß das Holz die Verkohlungstemperatur nur sehr
allmählich annimmt und niemals übersteigt, und daß in Folge hievon die Kohle die
Festigkeit und Dichtigkeit behält, welche man von derselben fordert, während sie
zugleich die höchste Heizkraft erlangt.
Tafeln