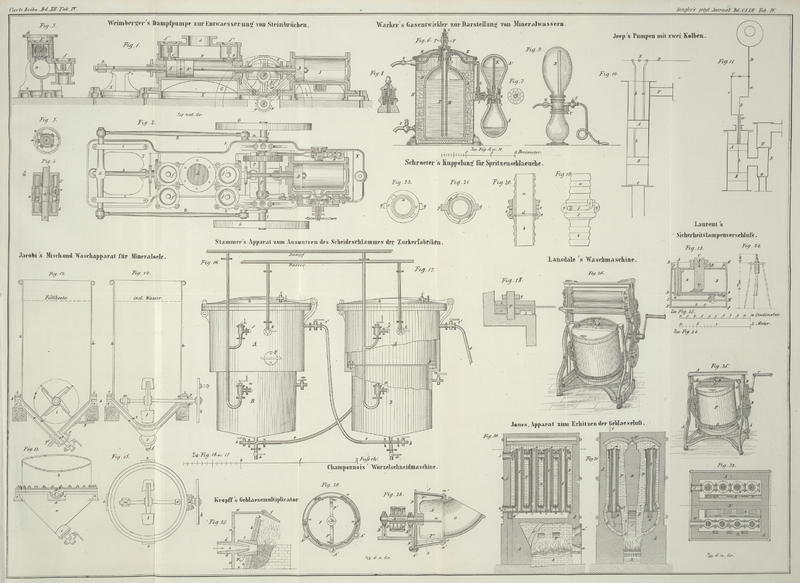| Titel: | Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche, vom Ingenieur Weimberger. |
| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. LXX., S. 241 |
| Download: | XML |
LXX.
Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche, vom
Ingenieur Weimberger.
Aus Armengaud's Génie industriel, August 1861, S.
81.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Weimberger's Dampfpumpe zum Entwässern der Steinbrüche.
Wenn man bei den Steinbrüchen bis zu einer gewissen Tiefe gelangt, so findet man
meistens so viel Wasser, daß man zum Auspumpen fast ununterbrochen Maschinen
anwenden muß, die also durch eine Dampfmaschine getrieben werden müssen.
In Belgien stellt man in solchen Fällen meistens Balanciermaschinen mit ihrem
Dampfkessel am oberen Rande und die Pumpen am Grunde des Bruches auf; die Verbindung
zwischen Dampfmaschine und Pumpe wird dann mittelst hölzerner, durch Eisen
verstärkter Gestänge bewirkt. Wegen der ziemlich beträchtlichen Entfernung zwischen
dem Tiefsten des Bruchs und der Sohle, in welcher die Maschine aufgestellt ist (25
bis 30 Met.), muß man dann verticale Mauern aufführen, an denen die Gestänge ihre
Leitung erhalten; dieß verursacht aber so große Kosten, daß man nicht selten auf die
Fortsetzung des Baues verzichtet.
Hr. Weimberger hat schon im J. 1859 diesen Uebelstand
dadurch zu vermeiden gesucht, daß er auch die Dampfmaschine mit ihrem Kessel am
Grunde des Steinbruches aufstellte. Eine solche Maschine, die natürlich einer
wesentlich geringeren Triebkraft bedarf und erhebliche Ersparnisse gestattet, ist in
dem Steinbruche der HHrn. Baatard zu Loignies (Belgien)
aufgestellt, und fördert im Durchschnitt per Minute 300
Liter Wasser auf die 25 Meter höher liegende Oberfläche des Steinbruches. Das
gußeiserne Steigrohr hat 12 Centimeter lichte Weite; es geht über eine Halde und
schafft das Wasser in ein bei einer Sägemühle befindliches Reservoir, von wo aus
dasselbe die Maschinen zum Steinschneiden in Bewegung setzt. Die ganze Länge dieser
Leitung beträgt etwa 80 Meter. Die Ausströmung ist constant, und man kann an ihr die
einzelnen Kolbenstöße nicht unterscheiden.
Fig. 1 der
bezüglichen Abbildungen stellt den Längendurchschnitt der Maschine durch die Achse
der Kolben dar, Fig.
2 den Grundriß mit Horizontaldurchschnitt durch den Dampfcylinder, Fig. 3 den
Durchschnitt nach der Linie 1–2 des Grundrisses, Fig. 4 und 5 den Vertical- und den
Horizontaldurchschnitt durch den Pumpenkolben.
Man erkennt zunächst, daß der Pumpen- und der Dampfkolben A und B direct verbunden sind und an einer
gemeinschaftlichen Stange b sitzen, welche über den
Pumpencylinder D hinaus verlängert ist, und hier ein
Querstück E trägt, welches sich in der Führung e bewegt.
Die Pumpe D ist doppeltwirkend und mit einem Windkessel
durch den Ansatz d verbunden. Auf diesem Windkessel
befindet sich das Steigrohr, welches ein Rückschlußventil enthält, um das Wasser in
vorkommenden Fällen in der Röhre festzuhalten.
Die Maschine macht höchstens 15 Kolbenspiele in der Minute.
Aus Fig. 3 ist
die Anordnung der Saugventile s und der Druckventile s' zu ersehen; dieselben haben eine kugelförmige
Berührungsfläche, und erhalten ihre Führung durch die Stiele i und i', welche zwischen cylindrischen
Bohrungen in den Deckeln f und f' der Ventilgehäuse gehen.
Die Querstange E am Ende der gemeinschaftlichen
Kolbenstange b treibt durch die Kurbelstangen R und die Kurbeln m die
Welle F, welche an dem einen Ende das Excentric g einer Farcot'schen
Expansionssteuerung und an dem anderen Ende das Excentric g' für die neben dem Dampfcylinder I liegende
Speisepumpe H trägt. Der Ring und die Stange des
Schieberexcentrics g besteht vollständig aus Messing und
die excentrische Scheibe ist an die Welle F
angeschmiedet; in den Umfang der letzteren ist eine Hohlkehle eingedreht, in welche
der Ring des Excentrics eingreift. Das Excentric g' der
Speisepumpe H besteht aus Gußeisen und ist zweitheilig;
Stange und Ring bestehen ebenfalls aus Gußeisen, der Hub beträgt 8 Centimeter. Die
beiden Kurbeln in sind an die Welle F angeschmiedet und
haben von Achse zu Achse 20 Centimet. Länge, woraus sich der Kolbenhub zu 40
Centimet. ergibt.
Da die geringe Geschwindigkeit der geradlinigen Kolbenbewegung befürchten ließ, daß
der Uebergang über die todten Punkte erschwert werde, so wurde noch folgende
Vorrichtung mit der Maschine verbunden: Ein zweitheiliges Zahnrad P auf der Welle F, welche
nicht über 15 Umdrehungen in der Minute macht, treibt ein Getriebe p, welches nur halb so groß als das Rad P ist, also doppelt so viel Umdrehungen als dieses
macht. Die Welle I, auf welcher das Getriebe p sitzt, trägt an ihren Enden die Schwungräder G; ihre Lager sind an die Fundamentplatte X angegossen. Damit die Bewegung der Kolben eine
möglichst regelmäßige werde, sind die Schwungräder mit zwei gußeisernen Gegengewichten verbunden, von
denen jedes 60 Kilogr. wiegt. Diese Gewichte sind zwischen den Schwungradarmen so
befestigt, daß sie in einer gemeinschaftlichen Horizontalebene liegen, wenn die
Kolben sich an den todten Punkten befinden. Der Pumpenkolben A, A' sitzt vermittelst einer conischen Verstärkung b' der Kolbenstange b auf dieser fest und hat
eine Rothgußliederung a, die ihren Druck wie bei den
Dampfkolben durch Keile und Federn, a' empfängt. Damit
an den beiden Enden des Pumpencylinders sich keine Luft ansammeln kann, sind die
beiden Kolbenkörper A und A'
so weit verlängert, daß sie bei ihrer Bewegung bis an die Cylinderdeckel reichen,
und den von den Druckventilen überragten Raum vollständig einnehmen. Aus gleichem
Grunde sind den Ventilgehäusen möglichst kleine Dimensionen gegeben.
Tafeln