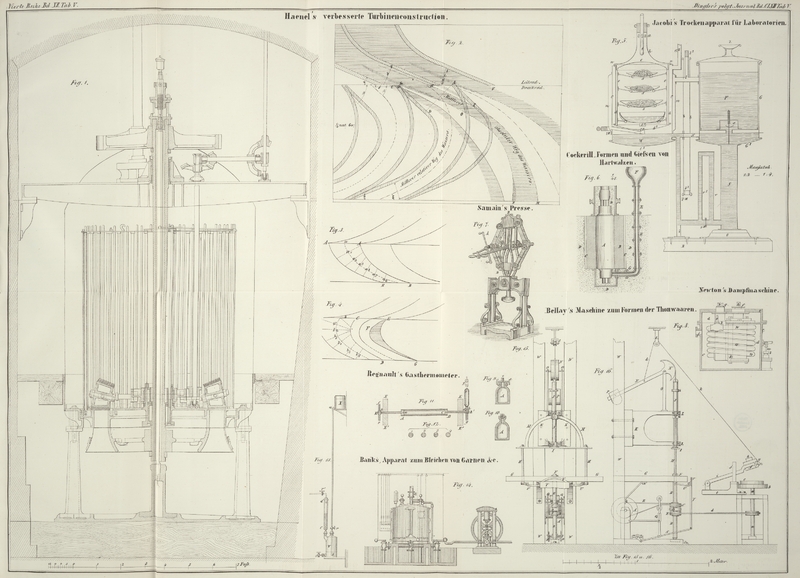| Titel: | Ueber ein Gasthermometer zum Messen hoher Temperaturen; von V. Regnault. |
| Fundstelle: | Band 162, Jahrgang 1861, Nr. C., S. 362 |
| Download: | XML |
C.
Ueber ein Gasthermometer zum Messen hoher
Temperaturen; von V.
Regnault.
Aus den Annales de Chimie et de Physique, September 1861,
S. 39.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Regnault, über ein Gasthermometer zum Messen hoher
Temperaturen.
Die verschiedenen Pyrometer, welche man vorgeschlagen hat, um die hohen Temperaturen
in den zu technischen Zwecken gebräuchlichen Oefen zu messen, haben bisher noch
keine allgemeine Anwendung gefunden. Diejenigen, welche sich auf die Ausdehnung
(oder die Zunahme der Spannkraft) der Luft in einem hermetisch geschlossenen Raume
gründen, sind schwer auszuführen und kostspielig, überdieß können sie nur von
solchen Personen benützt werden, die in den Manipulationen für physikalische
Beobachtungen sehr geübt sind.
Die Pyrometer, welche auf der verschiedenen Ausdehnung beruhen, die zwei Metalle und
ein Porzellanstab erleiden, können eigentlich nur als Pyroskope betrachtet werden,
um annähernd nachzuweisen, ob ein und derselbe Ofen bei mehreren auf einander
folgenden Operationen immer wieder bis zu der gleichen Temperatur erhitzt wird; denn
es ist zu schwierig, diese Instrumente zu graduiren oder sie selbst nur mit einem
Normalinstrument zu
vergleichen, um ihre Angaben in die Grade unserer gewöhnlichen Thermometerscala zu
übersetzen. Endlich erleidet das Instrument unter dem Einflusse der hohen
Temperaturen beständige Aenderungen, durch welche seine Scala gestört und die
Vergleichbarkeit seiner Angaben unmöglich gemacht wird.
Das Pyrometer von Wedgwood, welches sich auf das Schwinden
eines und desselben Thonstabes bei den verschiedenen Temperaturen gründet, kann
ebenfalls nur als Pyroskop dienen, und läßt noch mehr, als jene, zu wünschen übrig;
denn die Zusammenziehung, welche ein und derselbe Thon bei einer und derselben
Temperaturerhöhung erleidet, hängt von dem Grade der Zusammendrückung ab, welcher
man ihn im rohen Zustande ausgesetzt hat, ferner von der mehr oder weniger schnellen
Zunahme der Temperatur, von der längeren oder kürzeren Einwirkung der Wärme etc.
Ich habe im J. 1846 (Mémoires de l'Académie des
Sciences t. XXI p. 267) einen leicht zu
handhabenden Apparat vorgeschlagen, mittelst dessen man mit hinreichender
Genauigkeit in einem gegebenen Zeitpunkt die an irgend einer Stelle des Ofens
herrschende Temperatur messen kann. Derselbe besteht, wie Fig. 9 der bezüglichen
Abbildungen zeigt, in einer kugelförmigen oder cylindrischen Flasche A aus Gußeisen, Schmiedeeisen, Platin oder Porzellan,
deren Fassungsraum 1/2 bis 1 Liter beträgt; der Hals a,
b dieser Flasche ist durch eine aufgeschlissene Platte c, d geschlossen, die mit einer Mündung o versehen ist. In diese Flasche füllt man 15–20
Gramme reines Quecksilber, und stellt sie in dem heißen Ofen an die Stelle, deren
Temperatur man messen will. Das Quecksilber kommt sofort zum Kochen, treibt die Luft
aus, und entweicht selbst zum Theil in Dampfform durch die Mündung o. Nachdem die Flasche die Temperatur des Ofens
angenommen hat, zieht man die Platte c, d so weit nach
vorn, daß die Mündung o nahezu oder ganz verschlossen
wird, nimmt die Flasche heraus, und läßt sie rasch erkalten. Jetzt braucht man nur
noch das in der Flasche zurückgebliebene Quecksilber zu wägen; man gießt es aus,
nachdem man zuvor Wasser zugesetzt und die Flasche geschüttelt hat, und wägt es
entweder direct, oder löst es, wenn es verunreinigt worden ist, in einer Säure, und
wägt es dann in gefälltem Zustande.
Dem Hals der Flasche kann man auch die in Fig. 10 dargestellte
Gestalt geben. Derselbe endigt alsdann in einem erweiterten conischen Theil, und auf
dessen Oeffnung stellt man eine Kugel B, welche aus
demselben Material wie die Flasche besteht. Diese Kugel schließt nicht hermetisch,
verhindert aber die im Ofen befindlichen Gase, sich mit dem Quecksilberdampf im
Innern der Flasche zu mischen.
Es seyen:
V der Fassungsraum der Flasche bei 0⁰ in Kubikcentimetern; man findet denselben
durch Wägung des zum Füllen der Flasche erforderlichen Wassers;
k der Coefficient der kubischen Ausdehnung für das
Material, aus welchem die Flasche besteht;
H der Barometerstand in dem Zeitpunkt, wo man die
Flasche aus dem Ofen herauszieht;
h die Differenz zwischen den Spannungen im Ofen und in
der umgebenden atmosphärischen Luft; diese Differenz ist zwar häufig zu
vernachlässigen, man kann sie aber auch leicht mit Hülfe eines Wassermanometers
bestimmen,
H₀ der Barometerstand H
– h, auf 0⁰ reducirt;
die theoretische Dichtigkeit des
Quecksilberdampfs im Verhältniß zur Luft bei gleichen Temperaturen und Spannungen,
d.h. die Dichtigkeit des Quecksilberdampfes bei solchen Temperaturen, bei welchen
Quecksilberdampf und Luft den gleichen Gesetzen der Ausdehnung und Zusammenziehung
folgen; denn nur bei diesen kann das beschriebene Pyrometer genau die
Temperaturgrade angeben;
p das Gewicht des in der Flasche zurückbleibenden
Quecksilbers.
Das Gewicht Quecksilberdampf, welches die Flasche bei der Maximaltemperatur x erfüllt, ist
p = V (1
+ kx)/(1 + αx)
0,0012932δ H₀/760,
woraus folgt:
(1 + kx)/(1 + αx) = 760/(V . 0,0012932 δ) . p/H₀,
oder, wenn man die für eine und dieselbe Flasche constante
Größe
760/(V . 0,0012932 δ)
mit M bezeichnet,
(1 + kx)/(1 + αx) = M . p/H
Hieraus wird
Textabbildung Bd. 162, S. 363
α ist 0,00367.
Das eben beschriebene Verfahren kann sich in vielen Fällen nützlich erweisen; allein
es erfordert das Einführen des Apparats in den Ofen und das Herausziehen desselben
aus dem Ofen, und dieß kann störend auf den Gang des Ofens einwirken. Ich habe noch
einen anderen Apparat construirt, welcher dem älteren insofern vorzuziehen ist, als
er immer an seiner Stelle stehen bleibt, und dabei zu jeder Zeit das Messen der
Temperatur, auch wenn diese sich verändert, gestattet. Derselbe wird zunächst zur
Bestimmung der Temperaturen dienen, bei welchen man in der kaiserlichen
Porzellanfabrik zu Sèvres das Einbrennen der Emails und der Malereien in das
Porzellan ausführt.
Dieser Apparat besteht aus einer schmiedeeisernen Röhre A,
B (Fig.
11), deren Länge von der Ausdehnung des Raumes, dessen Temperatur man
bestimmen will, abhängt. Ihre lichte Weite schwankt zwischen 2 und 5 Centimeter, und
ist um so größer zu nehmen, je kürzer die Röhre ist. An beiden Enden ist die Röhre
durch aufgeschraubte und festgelöthete, schmiedeeiserne Scheiben geschlossen, und
von diesen gehen schmiedeeiserne Capillarröhrchen a, b
und c, d aus, die bis durch die Ofenwände C, C' hindurch fortgesetzt sind. Diese Röhrchen zieht
man aus Cylindern, die aus sehr weichem Eisen bestehen, und die man vorher geglüht
und in der Richtung der Achse mit 3 bis 4 Millimeter Lochweite durchbohrt hat. Beide
Capillarröhrchen münden außerhalb der Ofenwände in Dreiweghähne R und R'.
Mit Hülfe des Hahnes R kann man die weite Röhre A, B nach einander mit den Rohrleitungen e und f in Verbindung
setzen, und durch den Hahn R' ist die Röhre A, B mit den Rohrleitungen g
und h in Communication zu bringen. Die Leitung h ist an ein Kupferrohr l
angeschweißt, welches mit Kupferoxyd angefüllt ist.
Will man die Temperatur des Ofens in einem gegebenen Zeitpunkt bestimmen, so bringt
man die Hähne R und R' in
die Stellungen, welche Fig. 11 angibt, und setzt
die Leitung f mit einem Apparate in Verbindung, welcher
ununterbrochen trockenes und vollkommen gereinigtes Wasserstoffgas entwickelt. Das
Wasserstoffgas treibt die Luft aus der Röhre A, B aus
und entfernt sie durch die frei bleibende Mündung der Leitung g. Die Wasserstoffentwickelung setzt man so lange fort, bis die Luft
vollständig ausgetrieben ist; das Oxyd, welches etwa an der Innenwand der Röhre A, B anhängen könnte, wird dabei in den metallischen
Zustand zurückgeführt.
Darauf dreht man den Hahn R in die Stellung 2 (Fig. 12),
hängt den Wasserstoffapparat von der Leitung f
ab, und setzt die Leitung e mit einem Apparat in Verbindung, welcher zu dem geeigneten Zeitpunkte
mit einer beliebig zu
regulirenden Geschwindigkeit trockene Luft entwickelt. Dieser Apparat, der in Fig. 13
dargestellt ist, besteht in einer Flasche V, in welche
aus einem höher liegenden Reservoir X durch ein Bleirohr
a, b Wasser zugeleitet wird; die Menge des
Wasserzuflusses wird durch einen Hahn r in der
Rohrleitung a, b regulirt. Die Luft aus der Flasche V geht durch eine Röhre c,
d, in welcher mit concentrirter Schwefelsäure getränkter Bimsstein sich
befindet. Wenn der Hahn r' geschlossen ist, so nimmt die
Luft in der Flasche V eine höhere, als die
atmosphärische Spannung an, weil die Wassersäule in der Röhre a, b auf sie drückt.
Die Röhre A, B ist jetzt mit Wasserstoffgas gefüllt,
dessen Spannung H₀ der Spannung der Atmosphäre
gleich ist; seine Temperatur x ist aber unbekannt. Das
mit Kupferoxyd gefüllte Kupferrohr C wird durch eine
intensive Gasflamme bis zum Rothglühen erhitzt, und durch die Leitung i mit einem Uförmig
gebogenen Rohre S, das mit einer abgewogenen Quantität
mit Schwefelsäure getränkten Bimssteins gefüllt ist, in Verbindung gesetzt. Der Hahn
R ist jetzt in der Stellung 2, und der Hahn R' in der Stellung 3 (Fig. 12). Nachdem man den
Hahn R auf ganz kurze Zeit und nur wenig geöffnet hat,
um das Wasserstoffgas aus der Leitung l auszutreiben,
bringt man den Hahn R' in die Stellung l und endlich den Hahn R in
die Stellung 3. Oeffnet man jetzt vorsichtig den Hahn r'
(Fig.
13), so tritt die trockene Luft langsam in die Röhre A,
B über, treibt das Wasserstoffgas aus derselben aus, verbrennt es dabei zum
Theil, und zwingt den nicht verbrannten Theil, durch das Kupferoxyd zu gehen, das
die Verbrennung vollendet; das durch die Verbrennung entstehende Wasser schlägt sich
an der Bimssteinfüllung der Röhre S nieder. Den
Luftstrom läßt man so lange durch die Röhre A, B gehen,
bis das Wasserstoffgas und der Wasserdampf vollständig ausgetrieben sind; das
reducirte Kupferoxyd oxydirt sich dabei von neuem.
Es seyen:
V der Fassungsraum des Apparats bei 0⁰ in Kubikcentimetern;
δ die Dichtigkeit des Wasserstoffgases im
Verhältniß zur Luft;
α der Ausdehnungscoefficient des
Wasserstoffgases;
k der Coefficient der kubischen Ausdehnung für das
Metall, aus dem die Röhre A, B besteht;
P das Gewicht des in der Röhre S angesammelten Wassers.
Dann ist
12,5/112,5 P = V (1 + kx)/(1 + αx) δ 0,0012932 H/760
Bei einem Vorversuch, den man vor dem Einführen der Röhre A,
B in den Ofen anzustellen hat, umgibt man die Röhre A, B mit schmelzendem Eis und verfährt im Uebrigen auf die beschriebene Weise.
Dadurch erhöht man das Gewicht P' des Wassers, welches
der durch den Apparat gehende Wasserstoff bei der Temperatur von 0⁰ und der Spannung H' liefert. Für diesen Vorversuch wird
12,5/112,5 P' = V δ . 0,0012932 H'/760
Durch Division der beiden letzten Gleichungen erhält man
(1 + kx)/(1 + αx) = P/H . H¹/P¹
Der Werth H'/P', der durch den Vorversuch mit dem
schmelzenden Eise bestimmt wird, bleibt für alle zu ermittelnden Temperaturen
constant; nennt man ihn M, so geht die Gleichung über
in
(1 + kx)/(1 + αx) = M . P/H,
woraus sich ergibt:
Textabbildung Bd. 162, S. 366
Die Ermittelung der Temperatur nach diesem Verfahren erfordert nur sehr wenig Zeit,
und der Apparat ist schnell zur Anstellung eines neuen Versuchs fertig gemacht. Man
kann daher mit Hülfe desselben sehr leicht den Gang der Temperatur in ihrer Ab- oder
Zunahme beobachten.
Tafeln