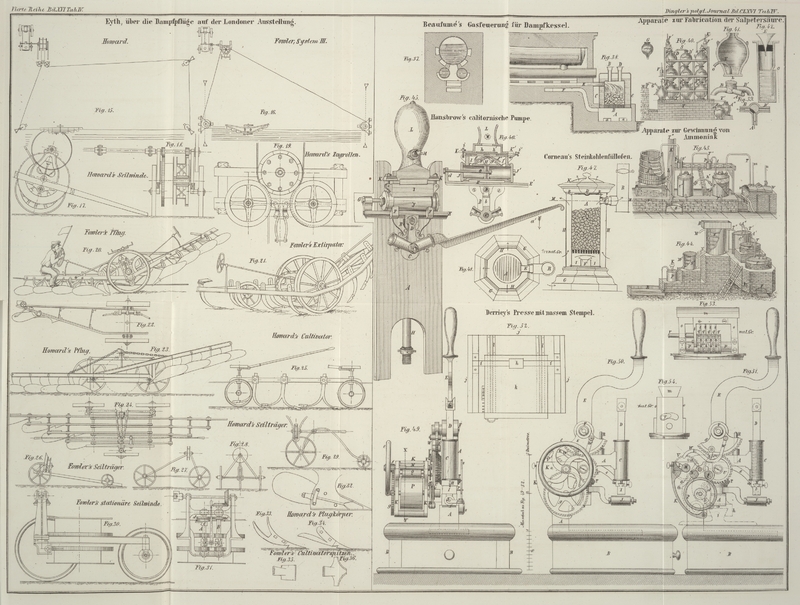| Titel: | Verbesserungen bei der Fabrication der Salpetersäure. |
| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XLIV., S. 493 |
| Download: | XML |
XLIV.
Verbesserungen bei der Fabrication der
Salpetersäure.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Verbesserungen bei der Fabrication der Salpetersäure.
Bei der Fabrication der Salpetersäure ist bekanntlich die den Verdichtungsapparat
verlassende Säure durch aufgelöste Untersalpetersäure roth gefärbt. In diesem Zustand
eignet sie sich für viele Anwendungen, so z.B. zur Darstellung der Schwefelsäure;
für die meisten Zwecke aber muß sie vorher in farblose, von NO⁴ vollkommen
freie Salpetersäure übergeführt werden, was durch das sogenannte Bleichen (blanchiment), und zwar auf die Weise geschieht, daß man
die Salpetersäure in gläsernen Ballons, die in einem bis auf 80 bis 90° C.
erhitzten Wasserbade sich befinden, erhitzt, so lange als noch rothe Dämpfe
entweichen, welche letztere man entweder in die Schwefelsäurekammer leitet oder
durch ein Rohr ins Freie führt. In der jüngsten Zeit sind nun in der
Salpetersäurefabrication wichtige Verbesserungen aufgetaucht, die sich theils auf
die Umgehung des Bleichens, theils auf die Condensationsapparate beziehen. In
ersterer Hinsicht ist eine in der Fabrik von Chevé
übliche Vorrichtung anzuführen. Es ist dem Praktiker bekannt, daß die rothen Dämpfe
bei der Fabrication der Salpetersäure sich nur bei Beginn und gegen das Ende der
Destillation bilden. Man braucht daher nur fractionirt zu destilliren, um einerseits
rothe Säure, andererseits weiße Säure zu erhalten, die, ohne der Bleichung zu
bedürfen, sofort in den Handel gebracht werden kann. Zu dem Ende wendet man einen
Hahn aus Steinzeug von der in Fig. 39 abgebildeten Form
an, dessen Rohr A mit dem Destillirapparat in Verbindung
steht, während die Rohre B und B' in verschiedene zum Auffangen bestimmte Ballons münden. Der Hahn ist so
gebohrt, daß man nach Belieben die Communication zwischen A und B, wobei B
abgeschlossen ist, oder zwischen A und B' herstellen kann. Durch geeignetes Stellen des Hahnes
kann man daher die rothe Säure von der weißen vollständig und kostenfrei
trennen.
Die zweite Verbesserung, von Plisson und Devers herrührend, bezieht sich auf den
Condensationsapparat, der aus einer Batterie von 10 Flaschen besteht, von denen 6
unten offen sind und in Trichter endigen, so daß sie in die Mündungen gewöhnlicher
Flaschen passen. G (Fig. 40) zeigt eine
solche unten offene Flasche. Aus dem hinter dem Mauerwerk M versteckten Cylinder geht ein Rohr aus Steinzeug, mit welchem ein
zweimal gebogenes Glasrohr G' in Verbindung steht, das
in eine der drei Mündungen der ersten Flasche A führt.
In dieser Flasche sammelt sich das zuerst Uebergehende, das, was vielleicht
übersteigt, und überhaupt, alle Unreinigkeiten. Die Flasche A ist inwendig mit einem kleinen Rohr T
versehen, das einen hydraulischen Verschluß bewirkt, in der Weise, daß, wenn die
Flüssigkeit in der Flasche eine Höhe von einigen Centimetern erreicht hat, der
Ueberfluß durch das Rohr T in die gut verschlossene
Flasche A' abfließt. In der zweiten Mündung der Flasche
A ist ein Trichter, durch welchen Wasser aus F in die Flasche A
fließt und die
Condensation unterstützt. Durch ein Glasrohr S gehen die
Säuredämpfe aus der Flasche A in die Flasche B, welche, ebenso wie die beiden Flaschen B' und B'', die in ihnen
verdichteten Producte durch das Rohr T' in den Ballon
A'' führt. Die in B
nicht condensirten Dämpfe gehen nach C und von da nach
D; in diesen beiden Flaschen verdichtet sich ein
Theil der Säure, der nach B und endlich nach A fließt; der nicht condensirte Rest geht durch das
Glasrohr S' nach D', dann
nach C'' und endlich nach B', worin die verdichteten Theile sich ansammeln. Von da gehen die Dämpfe
durch die Flaschen B'', C'', D'', und aus der letzten
Flasche das, was noch nicht verdichtet ist, in den Rauchfang. Aus den Mariotte'schen Flaschen F'
und F'' fließt Wasser zu, was im Verein mit dem Wasser
aus F die producirte Säure bis auf 36°
Baumé (= 1,31 spec. Gewicht = 42,2 Proc. NO⁵) verdünnt. Um jedem Druck
in den Flaschen A' und A''
vorzubeugen, geht ein Rohr H und ein ähnliches H' (in der Abbildung weggelassen) von T und T' ab, um die nicht
verdichteten Dämpfe in die Flasche B'' zu führen, wo sie
sich mit dem nicht condensirten Reste vereinigen. Der ganze Apparat, der auf den
ersten Anblick complicirt zu seyn scheint, ist äußerst leicht zu handhaben; die
Säuredämpfe condensiren sich im Anfange in der Flasche A, aus welcher sie in einen besonderen Recipienten A' geführt werden; daraus verdichten sie sich in den Flaschen B, B', B'', aus welchen das Product in den allgemeinen
Recipienten A'' fließt.
Dieser neue Verdichtungsapparat ist äußerst vortheilhaft. Einmal zusammengesetzt,
braucht er nur sehr selten aus einander genommen zu werden. Die Handarbeit des
Leerens und Zusammenfügens bei dem gewöhnlichen Apparat und der damit
zusammenhängende große Kittverbrauch fallen bei dem neuen Apparat hinweg. In Folge
des langen Weges, den die Dämpfe zurückzulegen haben, geht die Condensation
vollständiger vor sich, wie die Ausbeute von 132 bis 134 Kilogr. Säure von
36° B. auf 100 Kilogr. Salpeter beweist, während die älteren Apparate nur 125
bis 128 Kilogr. liefern.
Die innere Einrichtung der Flaschen und der den hydraulischen Schluß bewirkenden
Hebertrichter ergibt sich aus Folgendem. In jeder der Flaschen der unteren Reihe
befindet sich ein gebogenes Rohr aus Steinzeug T (Fig. 41),
dessen Mündung O ins Freie geht; eine spaltförmige
Oeffnung L stellt die Communication zwischen der
Flüssigkeit und dem Innern der Röhre her; die Flüssigkeit kann demnach in der
Flasche nur bis zu einer gewissen Höhe sich ansammeln. Es ist klar, daß hierdurch
die Flasche einen hydraulischen Schluß erhält. Der Hebertrichter besteht aus einem
thönernen Rohr von etwa 3 Centimetern Durchmesser, dessen Seitenwand der Länge nach
durchbohrt ist (Fig. 42); die in das Innere der Röhre gelangende Flüssigkeit kann mithin
nur bis zur Oeffnung O steigen; sobald diese Höhe
erreicht ist, fließt die Flüssigkeit in demselben Verhältniß aus, als durch den
Trichter E nachströmt. (Aus dem Dictionnaire de Chimie industrielle von Barreswil und Girard, durch Wagner's Jahresbericht für chemische Technologie,
Jahrgang 1861.)
Tafeln