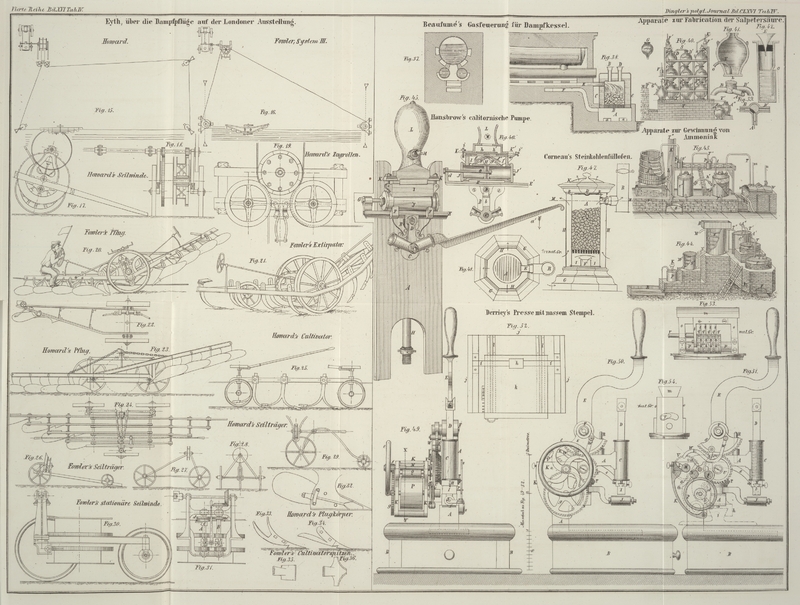| Titel: | Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak aus Harn und aus dem Condensationswasser der Gasfabriken. |
| Fundstelle: | Band 166, Jahrgang 1862, Nr. XLVIII., S. 201 |
| Download: | XML |
XLVIII.
Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak
aus Harn und aus dem Condensationswasser der Gasfabriken.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Verfahrungsarten bei der Gewinnung von Ammoniak aus Harn und aus
dem Condensationswasser der Gasfabriken.
Die Bereitung von Ammoniaksalzen aus gefaultem Harn gründet sich auf die Flüchtigkeit
des darin enthaltenen kohlensauren Ammoniaks und auf die daraus folgende
Möglichkeit, dasselbe durch Destillation von der Flüssigkeit zu trennen. Der von Figuera construirte und in dessen Fabrik in Bondy bei
Paris angewendete Destillationsapparat verdient auch in Deutschland bekannt zu
werden, da seltsamer Weise selbst die neuesten Werke über chemische Producte aus
Thierabfällen über die Verwerthung des Harns auf Ammoniaksalze schweigen. Der Inhalt
der Latrinen und Cloaken von Paris wird in la Villette deponirt und von da aus
mittelst colossaler Pumpen in ein Leitungsrohr getrieben, welches, mit dem Quercanal
parallel laufend, in der Entfernung von einigen Kilometern in die großen Reservoirs
mündet, die in der Nähe von Bondy, mitten im Walde gleichen Namens, liegen. Nach
längerer oder kürzerer Zeit scheidet sich in diesen Reservoirs ein fester Rückstand
ab, der nach der Gährung und dem Trocknen unter dem Namen Poudrette in den Handel
geht. Die über diesem Absatz stehende Flüssigkeit zapft man in andere Bassins ab,
nachdem sie sich vollständig geklärt hat. Man nennt diese Flüssigkeit Eaux vannes; wir wollen sie Gülle nennen. So wie
dieselbe in die Bassins kommt, enthält sie nur kleine Mengen von Ammoniak, das aber
in großer Menge sich bildet, sobald die Flüssigkeit in Fäulniß tritt, was sehr bald
der Fall ist. Nach etwa einem Monat ist die Fäulniß beendigt und die Gülle kann zur
Fabrication der Ammoniaksalze verwendet werden. Das durch die Fäulniß entstandene
kohlensaure Ammoniak wird durch Erhitzen verflüchtigt und der Dampf in eine saure
Flüssigkeit geleitet. Der hierzu angewendete Apparat von Figuera besteht wesentlich aus einem Dampfkessel, dessen Dampf in zwei
große Blechgefäße strömt, die er erhitzt und aus welchen er das kohlensaure Ammoniak
austreibt, das die darin enthaltene Gülle enthält; das kohlensaure Ammoniak
verdichtet sich zunächst in dem bleiernen Schlangenrohr eines Kühlapparates und
gelangt endlich in eine saure Flüssigkeit, wodurch es in schwefelsaures Ammoniak
übergeführt wird. Fig. 43 zeigt die Einrichtung dieses Apparates. A ist ein großes Holzgefäß, das 250 Hektoliter Gülle faßt und mittelst des
Rohrs h gefüllt wird; C und
C'
sind zwei Blechgefäße
mit einer Capacität von je 100 Hektolitern, P und P' sind kleine ähnliche Gefäße, deren Bestimmung unten
gesagt werden wird. Zunächst wird der Dampfkessel W,
welcher 130 Hektoliter faßt, mit der (durch die vorige Destillation fast
erschöpften) Flüssigkeit aus C und C' gefüllt; sie enthält noch geringe Mengen von
Ammoniaksalzen und hat außerdem eine so hohe Temperatur, daß die Operation
ununterbrochen fortgehen kann. In die Gefäße C und C' füllt man die in dem Bottich A vorgewärmte Gülle. Ein von dem Boden des Bottichs A ausgehendes Rohr h' führt die Gülle nach C, und ein zweites Rohr h''
die Gülle von C nach C',
worauf A mit neuer Gülle gespeist wird. Der Dampfkessel
ist mit drei Röhren versehen; T ist das
Dampfleitungsrohr und hat den größten Durchmesser; das Rohr m geht in den Kessel bis auf einige Centimeter vom Boden herab und erhebt
sich bis über die Bedachung der Fabrik; u ist ein
Sicherheitsrohr und zeigt zugleich durch Emporsteigen von Schaum an, wenn die
Flüssigkeit im Dampfkessel bis zur unteren Mündung des Rohres m gefallen ist; n endlich ist ein gewöhnliches
mit Hahn versehenes Rohr.
Nachdem die Gülle in die verschiedenen Gefäße vertheilt worden ist, wird der
Dampfkessel geheizt; der sich entwickelnde Dampf geht durch das Rohr T und nimmt die kleinen Mengen Ammoniak mit sich, welche
die Flüssigkeit im Dampfkessel noch enthielt. Der Dampf geht zunächst nach C, erhöht nach und nach die Temperatur der darin
befindlichen Flüssigkeit und entwickelt daraus kohlensaures Ammoniak, welches
vermittelst des Rohres t in das kleine Gefäß P entweicht. Die Function dieses kleinen Apparates ist
folgende: Der in C einströmende Dampf bewirkt ein Wallen
der Flüssigkeit und eine beträchtliche Schaumbildung, deren Größe von dem Grade des
Siedens abhängig ist. Unter normalen Verhältnissen steigt der Schaum in dem Rohr t empor und darf selbst in P
eine gewisse Höhe erreichen, das Gefäß aber nie anfüllen, weil sonst zu fürchten
wäre, daß er in das Rohr T' steigen und die Flüssigkeit
in C' verunreinigen würde. Um zu sehen, wie hoch der
Schaum in dem Gefäße P steht, nimmt der Arbeiter von
Zeit zu Zeit einen der drei Holzpfropfen heraus, die drei Oeffnungen in
verschiedener Höhe an der Seite verschließen, und beobachtet, durch welche der
Oeffnungen der Schaum ausfließt. Hält er den Gang der Operation für zu rasch, so
mäßigt er das Feuer unter dem Kessel.
Aus dem Gefäß P geht der Dampf, der schon viel
kohlensaures Ammoniak enthält, durch T'' nach C', wo er auf die nämliche Weise wirkt wie in C, entweicht durch das Rohr t', passirt durch das zweite Probegefäß P' und
geht von da mittelst des Rohres T'' in das Bleirohr des
Kühlapparates, wo er
durch die Gülle, die das Schlangenrohr umgibt, abgekühlt und condensirt wird. Die
verdichteten Producte begeben sich durch das Rohr t'' in
einen mit Bleiplatten bekleideten Bottich, der die zur Sättigung des Ammoniaks
erforderliche Menge Schwefelsäure enthält.
Eine Destillation erfordert 12 Stunden; nach ihrer Beendigung wird der Dampfkessel
durch das Rohr v ausgeleert und sofort wieder mit Gülle
aus C und C' angefüllt,
worauf die Arbeit von Neuem beginnt. Der Ammoniakgehalt der in Bondy verarbeiteten
Gülle ist ein wechselnder und richtet sich nach der Jahreszeit, nach dem Alter der
Jauche u.s.w., im Durchschnitt aber wird angenommen, daß 1 Kubikmeter (= etwa 40
Kubikfuß) 9 bis 12 Kilogr. schwefelsaures Ammoniak liefern. Eine jede Destillation
liefert ungefähr 200 Kilogr. Da die Fabrik in Bondy elf Apparate hat, so producirt
sie täglich etwa 2500 Kilogr. (= 50 Ctr.) schwefelsaures Ammoniak, was einem Quantum
von 2500 bis 3000 Hektoliter Gülle entspricht. Die Verarbeitung des gefaulten Harns
ist deßhalb von großer Wichtigkeit und sie würde noch weit wichtiger seyn, wenn die
Agricultur von den dabei erzielten Ammoniaksalzen einen ausgedehnteren Gebrauch
machte, deren Preis 40 Fr. für den metrischen Centner (etwas über 9 Fl. rhein. für
den Zollcentner) nicht viel übersteigt, und wenn man in Paris jährlich nicht über
800,000 Kubikmeter Harn in den Gossen und Abzugscanälen verloren gehen ließe, die
ungefähr 7 bis 800000 Kilogr. schwefelsaures Ammoniak (=140 – 160000 Ctr.)
repräsentiren.
Um aus den Condensationswässern der Gasfabriken das Ammoniak zu gewinnen, wendet man
in Paris in mehreren Gasanstalten einen Apparat von Mallet an, welchem seiner Zweckmäßigkeit wegen die größte Verbreitung zu
wünschen ist. Er ist dem Apparat von Figuera sehr
ähnlich, nur von weit kleineren Dimensionen, weil das Condensationswasser viel
reicher an Ammoniak ist als die Gülle. Letztere liefert, wie oben gesagt, 9 bis 12
Kilogr. Sulfat per Kubikmeter, während das
Condensationswasser mindestens 50 Kilogr. ausgibt, so daß zur Herstellung von 100
Kilogr. dieses Salzes 20 Hektoliter Condensationswasser hinreichen, während von der
Gülle 100 Hektoliter (also das Fünffache) erforderlich sind. Fig. 44 zeigt den
Apparat. Er besteht aus drei staffelförmig übereinander stehenden gußeisernen
Kesseln C, C' und C''. C
steht direct über der Feuerung F und ist mit einem
Bleirohre T versehen, das vom Deckel des Kessels ausgeht
und in die Flüssigkeit des zweiten (eingemauerten) Kessels C' taucht, welche nach und nach erwärmt wird. Von C' geht ein Bleirohr T' nach dem dritten
Kessel C''. Jeder Kessel ist mit einem Mannloch und
einem Rührapparat A, A' und A'' versehen. Der dritte Kessel C'' steht vermittelst des Rohres T'' mit dem Schlangenrohr S
des Kühlapparates in Verbindung, in welchem kaltes Condensationswasser zum Kühlen
benutzt wird, das aus dem Reservoir B zuläuft und bei
M wieder abfließt. Aus dem Schlangenrohr S gehen die verdichteten und nicht verdichteten Producte
durch N in ein zweites Kühlrohr S', das ebenfalls durch Condensationswasser abgekühlt wird, von da in ein
Bleigefäß P, das mit einem Sicherheitsrohr versehen ist,
und endlich in ein flaches, mit Blei ausgefüttertes Gefäß, welches Schwefelsäure
enthält. Jeder der Kessel C und C' hat eine Capacität von 8 Hektolitern.
Stellen wir uns vor, der Apparat sey im Betrieb und das in C befindliche Condensationswasser habe bereits alles Ammoniak verloren, so
wird durch einen am unteren Theile des Kessels C
befindlichen Hahn die Flüssigkeit abgelassen und durch (zum Theil erschöpfte) aus
C' ersetzt; letzterer Kessel wird durch die
Flüssigkeit des dritten Kessels C'' gefüllt und in C'' Wasser aus den Kühlapparaten, welches dort bereits
vorgewärmt wurde, gepumpt. In diesen dritten Kessel kommt zugleich durch das
Mannloch eine gewisse Menge gelöschter und gesiebter Kalk, die dem sehr wechselnden
Gehalte des Condensationswassers an Ammoniakverbindungen entsprechen muß; die nach
C' und nach C herab
fließenden Wasser enthalten daher stets Kalk. Die Flüssigkeit in C wird durch das darunter befindliche Feuer bis zum
Sieden erhitzt; der Kalk zersetzt die letzten Antheile von kohlensaurem Ammoniak und
Schwefelammonium und bewirkt eine schwache Entwickelung von Ammoniakgas, welches mit
den sich entwickelnden Dämpfen in den Kessel C' gelangt;
von Zeit zu Zeit setzt ein Arbeiter den Rührapparat in Bewegung, um den Kalk
aufzurühren und dessen Ansetzen an den Boden des Kessels zu verhindern. Die
Flüssigkeit des zweiten Kessels C', sowohl durch die
Verbrennungsgase der Feuerung F, als auch durch die aus
C kommenden Dämpfe erhitzt, verhält sich ganz
ähnlich und sendet durch das Rohr T'' nach C'' ein Gemisch von Ammoniak mit Wasserdampf. In dem
dritten Kessel C'' findet derselbe Vorgang statt; die
flüchtigen Producte gelangen zunächst, wie oben gesagt, in die beiden Kühlapparate,
dann in das Bleigefäß P, welches man von Zeit zu Zeit
mit etwas Kalk versieht, um die letzten Spuren der Ammoniaksalze, welche sich der
Zersetzung in den Kesseln entzogen haben, zu zersetzen. Endlich gelangt das fast
reine Ammoniakgas in das Sättigungsgefäß R, dessen
Flüssigkeit nach geschehener Neutralisation zum Krystallisiren abgedampft wird. (Aus
dem Dictionnaire de Chimie industrielle von Barreswil und Girard, durch
Wagner's Jahresbericht für chemische Technologie,
Jahrg. 1861.)
Tafeln