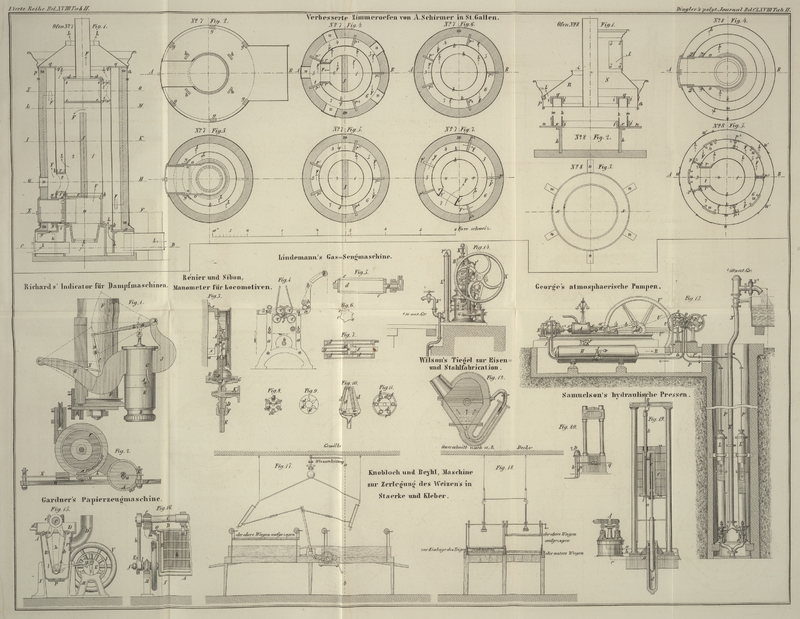| Titel: | Maschine und Verfahren zur fabrikmäßigen Zerlegung des Weizens in Stärke und Kleber, und zur Verwendung des Klebers auf Backwerke aller Art, von Knobloch und Beyhl. |
| Fundstelle: | Band 168, Jahrgang 1863, Nr. XXIX., S. 110 |
| Download: | XML |
XXIX.
Maschine und Verfahren zur fabrikmäßigen
Zerlegung des Weizens in Stärke und Kleber, und zur Verwendung des Klebers auf Backwerke
aller Art, von Knobloch und
Beyhl.
Aus dem Kunst- und Gewerbeblatt für Bayern, 1862 S.
690.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Knobloch's Maschine zur fabrikmäßigen Zerlegung des Weizens in
Stärke und Kleber.
Auf dieses Verfahren erhielten Dr. M. Knobloch, Professor in Weihenstephan und Adolph Beyhl, Mechaniker in München, am 15. Mai 1861 ein
zweijähriges Privilegium für Bayern.
Die Maschine, Fig.
17 und 18, besteht aus einem Systeme von Reibflächen, welche in Form von Wagen
aus starken Eisendrähten je paarweise parallell in horizontaler aber
entgegengesetzter Richtung sich bewegen. Der untere Wagen ist etwas länger, als der
obere, so daß letzterer bei seilten weitesten Bewegungen vor und rückwärts den
unteren noch deckt. Auf den inneren sich zugekehrten Flächen sind Strohmatten von
möglichst weichem Geflechte befestigt, und diese werden vor der Arbeit mit doppelten
Schürzen vom stärksten Käsetuche bekleidet. Die Wagen bewegen sich in Rahmen, welche
sie seitlich schließen, und ruhen auf einem Gestelle, das, unten abgeschlossen, die
erzeugte Stärkeflüssigkeit aufnimmt und sie den Rinnen zuführt, welche zu den
Absetzbottichen hinleiten. Die Wagenpaare liegen zu beiden Seiten der sie bewegenden
Achse; sie können mit der Verlängerung der letzteren beliebig vermehrt werden. Auch
die Größe dieser Wagen ist dem Belieben anheim gegeben;. indessen werden Dimensionen
von 20–24 Quadratfuß sich wohl als die zweckmäßigsten bewähren. Durch Hebel
und Räderwerk ist eine so ökonomische Verwendung der Kraft erzielt, daß mit 1
Pferdekraft leicht 420 Quadratfuß Reibfläche bewegt werden können. Sämmtliche
Bewegungen sind verstellbar, und lassen sich daher ganz nach Bedürfniß
reguliren.
Ueber den Wagen und gleichzeitig mit denselben bewegen sich Brausen, welche ihr
Wasser in einer berechneten Anzahl von Strahlen ergießen. Der Wasserzufluß kann so
regulirt werden, daß sich die Arbeit jeweilig mit der geringsten Wassermenge
verrichten läßt. Hierdurch ist an Arbeit, Raum und Geschirr sehr viel erspart, und
die Fabrication auch in wasserarmen Gegenden
ermöglicht.
Zur Verarbeitung wird der Weizen überall, wo der Gebrauch der englischen Mahlmaschine
nicht gestattet ist, auf einer gewöhnlichen Getreidemühle gemahlen. Man scheidet
bloß die Kleien ab, und erzeugt nur eine Sorte Mehl. Das letztere ist einige Stunden
vor der Verarbeitung mit reinem Wasser in einen steifen Teig zu verwandeln. Hierzu
dient die große englische Knetmaschine von Swan und Comp. in London, welche in je 5 Minuten 60 Pfd. Teig
liefert. Der Teig wird entweder mit freier Hand oder besser mittelst Schablonen in
Streifen geformt, die in bemessene Entfernungen zwischen die Wagen gelegt werden. Zu
diesem Zwecke läßt sich der obere Wagen parallel aufziehen. Sowie ein Wagenpaar
geladen ist, wird die zugehörige Brause angelassen und die Maschine in Bewegung
gesetzt, die von nun ab ununterbrochen bis zur gänzlichen Einstellung der Arbeit
fortgeht. Denn, indem jedes Wagenpaar einzeln für sich beladen und dann nachgefüllt
werden kann, ist das Princip der ununterbrochenen Arbeit gerettet. Ständig läuft die
Stärke in einem Milchstrome und so rein ab, daß bei vorsichtiger Arbeit nur Stärke
der Prima-Sorte gewonnen wird. Gleichwohl läßt sich auf Rinnen von schwachem
Gefälle noch Schlammstärke erzeugen, die nach der Anzahl und Länge der einzelnen
Rinnen nummerirt werden kann. Zwischen den Wagen bleibt der Kleber chemisch rein
zurück. Er beträgt im frischen Zustande (im Zustande des frischen Thierfleisches) im
Mittel 33 Procent von dem Gewichte des ausgewaschenen Mehles. In diesem Zustande ist
er für die Brodbäckerei nicht verwendbar; seine natürliche Zähigkeit widerstrebt der
Bereitung eines Teiges. An der Luft trocknet er äußerlich schnell ein zu einer
dunkelbraunen, harten hornartigen Masse, geht aber in größeren Portionen im Inneren
rasch in Fäulniß über. Dem reinen Wasser gegenüber – als solches gilt auch
noch gewöhnliches Bach- oder Brunnenwasser – bewährt er ein
ausgezeichnetes Verhalten. Bei 0° des Wassers und namentlich unter Eis oder
Schnee bleibt er lange Zeit völlig unverändert auch in seinen physikalischen
Eigenschaften; je nach der Temperatur des Wassers aber wird er ohne chemische
Veränderungen nach längerer oder kürzerer Zeit so weich, daß er sich selbst
zerrühren läßt. Dieß ist der Zustand seiner Bearbeitungsfähigkeit in der
Brodbäckerei. Der Bäcker hat es völlig in seiner Gewalt, durch Regulirung der
Temperaturen die Bearbeitungsfähigkeit auf einige Minuten voraus zu bestimmen. Und
nun kann man entweder den Kleber für sich einmehren, und setzt dann nach dem Triebe
die erforderliche Menge eines Mehles beliebiger Qualität zu; oder man mehrt das Mehl
für sich ein und gibt den Kleber beim Teigmachen. Das letztere Verfahren soll
handlicher seyn. In beiden Fällen erhält man einen ausgezeichneten Trieb und
Gebäcke, welche hinsichtlich ihres guten Aussehens, ihres
Wohlgeschmackes und ihrer Nahrhaftigkeit die Brode aus den gewöhnlichen Mehlsorten um vieles
übertreffen. Namentlich das Hauptkennzeichen eines vorzüglichen Backwerkes, die Vielzelligkeit, ist in überraschender Weise erreicht. Hr.
Bäckermeister Jais in München versichert, er habe
versuchsweise vermittelst eines Kleberzusatzes aus Mehlsorten vortreffliches Brod
erzeugt, welche für sich unter keiner Voraussetzung genießbare Waare geliefert
hätten.
Das Einweichwasser löst übrigens bei höheren Temperaturen Klebertheile auf; es wird
deßhalb nicht weggegossen, sondern zur Bereitung des Teiges mitverwendet.
Die Versendung des Klebers ist höchst einfach. Er adhärirt nicht an Leder und kann
somit in mit Schafleder ausgefütterten Kisten leicht verpackt werden. Eine geringe
Beigabe von frischem Wasser oder von Eis und Schnee ist sehr zu empfehlen. Und so
wäre denn die Zeit vielleicht nicht mehr sehr ferne, in welcher der Verkümmerung
mancher Gegenden in Folge schlechter Ernährung durch Zusendung des edlen
Weizenklebers Einhalt geboten werden kann.
Tafeln